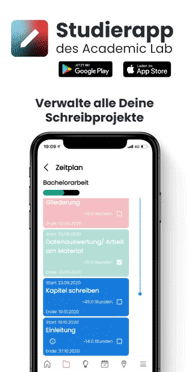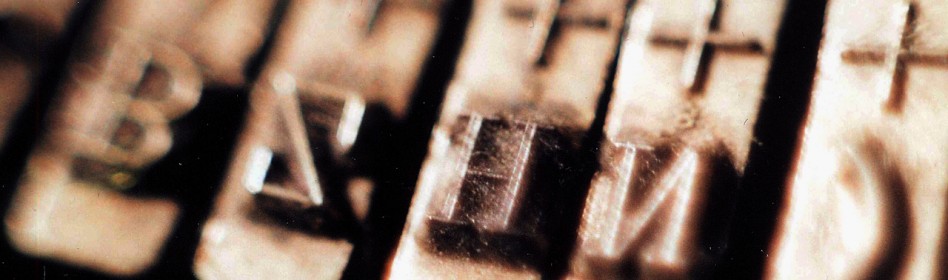
Paragraphing
In der englischen Wissenschaftssprache werden einzelne Absätze (paragraphs) mit deutlich mehr Technik systematisch und strukturiert aufgebaut. Dieses recht formale Vorgehen kann zwar den Nachteil haben, das Spiel mit der Sprache deutlich einzugrenzen, ist aber vor allem zur Selbstkontrolle sinnvoll. Wenn ein Absatz als kleinste Einheit der Textstruktur gut aufgebaut und in sich schlüssig ist, kann auch der Gesamttext lesbarer und argumentativ sauberer werden. Je präziser ein Absatz als Sinnheit gesetzt ist, desto logischer und durchdachter erscheint die Argumentation.
Tipp: Ein kleiner Test kann helfen, die Logik eines Absatzes zu prüfen. Lassen Sie jemanden, der Ihr Thema nicht oder nur bedingt kennt, einen Absatz aus Ihrem Text laut lesen. Ist der Absatz gut und schlüssig aufgebaut, sollte das Argument deutlich werden.
Ein Absatz lässt sich grob in drei Teile bzw. Sätze oder Satzgruppen zerlegen:
[tooltip tip=“In diesem Satz wird das zentrale Thema, die Grundidee des Absatzes platziert.“]topic sentence[/tooltip] | [tooltip tip=“In diesem Abschnitt, der auch zwei oder drei Sätze umfassen kann, wird die Grundidee des Absatzes entwickelt und mit Details ergänzt.“]supporting sentence[/tooltip] | [tooltip tip=“Ein abschließender Satz fasst die Grundidee des Absatzes noch einmal zusammen oder kommentiert das Vorangegangene. Wenn der Argumentationsgang weitergeht und mit dem nächsten topic sentence anschließt, kann dieser Teil auch entfallen.“]concluding sentence[/tooltip]
Die Länge eines Absatzes ist unbedingt vom Gegenstand bzw. dem zu verhandelnden Argument abhängig. Besonders der Mittelteil (supporting sentence) kann also länger werden. Mindestens besteht ein Absatz aber aus drei Sätzen. Dies zeigt bereits, dass eine arg zerklüftete Seite mit mehr als drei Absätzen eine unsaubere Argumentation erwarten lässt oder die Argumente zu stichpunktartig aufgelistet und nicht ausreichend erläutert werden.
Hier zwei Beispiele, wie Absätze idealtypisch entschlüsselt werden können:
blau: topic sentence – grau: supporting sentence(s) – schwarz: concluding sentence
Derridas Dekonstruktion […] des Zeichenbegriffs hat [tooltip tip=“Der Anschluss zum vorherigen Absatz.“]allerdings[/tooltip] weitreichende Folgen. Sie hebt unter anderem Saussures Privilegierung der gesprochenen Sprache und ihre Einordnung in die Psychologie auf, da der Zeichenbegriff im Sinne einer reinen Signifikantenkette ohne Einschränkung auch für die Schriftsprache und andere Symbolsysteme gilt. Derrida geht sogar noch weiter: Weil schon Aristoteles die Schrift als Zeichen des Zeichens oder, in der lingusitischen Terminologie: als Signifikant des Signifikanten definiert hat, nennt er das Verweisungsgefüge der Signifikanten eine „allgemeine Schrift“. Dieser spezielle Schriftbegriff geht indes über das alltägliche Verständnis des Schrift weit hinaus. Die Schrift, so Derrida in Grammatologie, ist kein Derivat der gesprochenen Sprache, sie kann vielmehr als Struktur das Funktionieren jeder sprachlichen Artikulation begreifen. Schrift wäre also der Name für ein System, in dem die Signifikanten aufeinander verweisen und allein aufgrund ihrer Differenz zueinander Bedeutung produzieren.
(Dirk Quadflieg: Sprache und Diskurs. Von der Struktur zur différance, in: Stephan Moebius/
Andreas Reckwitz (Hg.): Poststrukturalistische Sozialwissenschaft, Frankfurt/Main 2010, S. 103)
_
Neurophysiologische Onlinemessungen können bezüglich der zeitlichen Struktur der Verarbeitungsprozesse [tooltip tip=“Der Anschluss zum vorherigen Absatz.“]zusätzliche[/tooltip] Informationen liefern. Die zwei Messtechniken, die hierfür zur Verfügung stehen, sind die Elektroenzephalographie (EEG) und die Magnetoenzephalographie (MEG). Das EEG misst die elektrische Aktivität an der Kopfoberfläche, das MEG das entsprechende magnetische Feld. Beide Messmethoden erlauben die Registrierung ereigniskorrelierter Hirnaktivität, die sog. ereigniskorrelierten Hirnpotentiale (EKP), im Millisekundenbereich und liefern somit eine hohe Zeitauflösung.
(Angela D. Friederici: Neurobiologische Grundlagen der Sprache, in: Hans-Otto Karnath & Peter Thier (Hg.): Neuropsychologie, Heidelberg 2006, S. 346–356, hier: S. 346f.)
Aufgabenbeschreibung
Die nächste Textpassage ist fortlaufend, also ohne Absätze, dargestellt. Fügen Sie selbst Absätze in den Text ein. Hinter dem Lösungsvorschlag finden Sie die Umbrüche der Originalversion. (Aus Darstellungsgründen haben wir die Absätze durch Leerzeichen markiert, was eigentlich Abschnittswechsel wären.)
Absätze Übung 1
Was der Literaturwissenschaft fehlt, ist eine Historik des Schreibens. Ihre Arbeit – von der Interpretation bis zur Geschichtsschreibung – hat es durchgängig mit Effekten einer Praxis zu tun, die selber nicht mehr Thema wird. Was Dichter dachten oder auch Denker dichteten, ist durchforscht. Nur die sechsundzwanzig schwarzen Figuren auf weißem Grund – seit Jahrtausenden der Speicher aller Dichtung – haben ihr altes Rätsel gewahrt. Literaturwissenschaft aber siedelt nun einmal (den gängigen Parolen von Kommunikation zum Trotz) im Raum der Bibliotheken. Also kommt sie ihrer eigenen Sache gegenüber nie mehr rechtzeitig. Schrift ist schon da, bevor die Arbeit, die selber in Schreiben mündet, auch nur angefangen hat. Scripsi quod scripsi, sagte Pilatus, uneinholbar.
Aus dieser Lage gibt es allerdings Fluchtwege. Auch wenn die Literaturwissenschaft (im Unterschied zu Hohepriestern) Geschriebenem nicht mehr mit Änderungswünschen kommen, überspringen können sie es allemal. Zwei nachgerade klassische Wege, um Schrift zu neutralisieren, heißen ‚Werk‘ und ‚Autor‘. Entweder in einem Nachher oder einem Vorher verschwand das schlichte Vorliegen der Zeichen. Auf ein hergestelltes Gesamtwerk hin verstanden, wurden Schriftzeichen zum Vehikel eines Sinns, der sie alle übertraf und vereinheitlichte, schon weil er immer noch ausstand. Auf einen unterstellten Autor hin gelesen, verschwand Geschriebenes in der scheinbaren Vorgängigkeit einer Stimme oder eines Denkes. Was dastand, zählte nicht mehr; anstelle der Shrift in ihrer Macht trat ein Meinen in seiner Beliebigkeit. Die Hohepriester zu Pilatus: „Schreibe nicht ‚Der Juden König‘, sondern daß er gesagt habe ‚ich bin der Juden König‘.“
Daß die literaturwissenschaftliche Hermeneutik Geschriebenes ein Jahrundert lang auf die zwei Trugbilder reduzierte, die seit Saint-Beuve ‚Werk‘ und ‚Autor‘ heißen, hat Gegentheorien auf den Plan gerufen. Seit Barthes und seiner Nouvelle critique soll im Grundbegriff écriture die uneinholbare materielle Basis von Literatur zur Methode werden. Écriture bezeichnet eine Praxis ohne Grund im Autor und ohne Ziel im Werk, geregelt nur von Gesetzen, die die Sprache in ihrer Autonomie erläßt. Was den Literaturwissenschaftler, in einem schönen Kurzschluß, ebenso freisetzt wie den Schriftsteller.
So sind die Absätze im Original gesetzt. Sie umreißen jeweils eine Sinneinheit. Zudem haben wir, weil es hier so schön passt, den jeweiligen "topic sentence" unterstrichen, der meist relativ knapp einen Absatz einleitet.