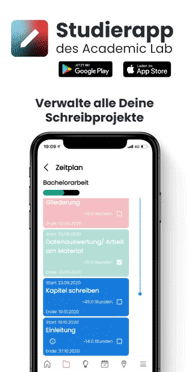Gender
Im Sinn der Gleichberechtigung bzw. -behandlung ist es seit einigen Jahren üblich, das generische Maskulinum (also die männliche Form, die für alle Geschlechter steht) zu vermeiden. Diskussionen zur konkreten Form und zum Sinn der Sache werden heiß geführt. Befürworter wie Gegner haben mehr oder weniger gute Argumente. Wir stellen im Folgenden einige Versionen vor, das unstrittig erstrebenswerte Ziel der Gleichberechtigung im Text zu verankern und weisen auf Probleme und sogenannte Hyperkorrekturen hin. Die Übungen sollen diese Schwierigkeiten unterstreichen und Möglichkeiten aufzeigen, wie drohende Probleme umgangen werden können.
Es gibt im Wesentlichen sechs Varianten, das generische Maskulinum zu vermeiden:
1. Konsequente Dopplung
Bei dieser Version wird nicht von „Lehrern“ oder „Politikern“ gesprochen, sondern immer von „Lehrerinnen und Lehrern“ bzw. von „Politikern und Politikerinnen“.
Vorteil:
Die Ausdrucksweise ist formal korrekt und beachtet die Gleichbehandlung.
Nachteil:
Sie behindert den Rede- und Lesefluss. Man hat schon Menschen von „Behörden und Behördinnen“ reden hören, was eine hyperkorrekte Form wäre, also auch an Stellen eingesetzt wird, an denen es gar nicht passt. Wenn Texte viel von oder über Personen(-gruppen) berichten, kann diese Schreibweise einige Stolpersteine bereithalten.
2. Das Binnen-I
Diese Version, die Gleichbehandlung im Schreiben zu verankern, ist recht üblich. Hier wäre von „LehrerInnen“ und von „PolitikerInnen“ die Rede.
Vorteil:
Beide Geschlechter werden in einem Begriff repräsentiert.
Nachteil:
Die Form ist nach den gültigen Rechtschreibregeln eigentlich unmöglich, weil es innerhalb eines Wortes keine Großbuchstaben gibt. Sie lässt sich zudem schlecht beugen und noch schlechter lesen, etwa im Singular bei „der/die aktive LehrerIn“ oder „ein/eine aktive/r LehrerIn“.
3. Die Klammervariante
Ähnlich wie beim Binnen-I kann die Dopplung auch in Klammern aufgerufen werden, also „Lehrer(innen)“ und „Politiker(innen)“.
Vorteil:
Beide Geschlechter werden in einem Begriff repräsentiert.
Nachteil:
Auch diese Version ist orthografisch fragwürdig und lässt sich schlecht lesen. Zudem wird die Sache kompliziert, wenn das Nomen gebeugt werden muss. Dann entstehen Passagen wie: „Die Interessen der Student(inn)en …“. Das macht die Sache kompliziert, und es ist mitunter sehr aufwendig, den Stil durchzuhalten. Darüber hinaus hat diese Schreibweise den etwas komischen Effekt, die feminine Form konsequent einzuklammern, was im Sinne der Gleichberechtigung wiederum auf Kritik stoßen könnte.
4. Generisches Femininum
In dieser Version werden die Dinge umgekehrt, und es wird für alles die feminine Version aufgerufen. Die Begriffe „Lehrerinnen“ oder „Politikerinnen“ sollen demzufolge beide Geschlechter repräsentieren. Dass jeweils kein einzelnes Geschlecht herausgehoben ist, wird dann zumeist in einer Fußnote am Beginn des Textes vermerkt. (Das geht übrigens auch für das generische Maskulinum.)
Vorteil:
Die Hierarchien werden, wenn man so will, umgekehrt. Diese Version ist grammatisch sauber und behindert zumindest auf den ersten Blick die Lesbarkeit nicht.
Nachteil:
Das generische Maskulinum ist im Bewusstsein der Lesenden häufig so tief versenkt bzw. so solide eingeübt, dass konsequent feminine Formen für einige Verwirrung sorgen können. Intuitiv liest es sich wiederholt so, als ob tatsächlich nur Frauen gemeint wären. Der Satz: „Studentinnen der Medizinischen Fakultät haben sich im Vergleich zum Vorjahr bei ihren Examensergebnissen signifikant verschlechtert.“ provoziert schnell das Bild, es würde sich nur um die weiblichen Studierenden handeln.
5. Wechselmodell
Bei dieser Variante wird beliebig zwischen femininen und maskulinen Formen gesprungen.
Vorteil:
Beide Geschlechter werden – im Idealfall – zu gleichen Teilen repräsentiert.
Nachteil:
Wenn doch mal nur die eine oder andere Gruppe adressiert werden soll, wird die Sache sehr kompliziert. Zudem greift der unter 4. beschriebene Reflex auch hier; man liest das Geschlecht unweigerlich mit.
6. Alternative Formulierungen
Für einige Bezeichnungen funktionieren vor allem das Binnen-I oder die Klammervariante, aber auch das Generische Femininum oder das Wechselmodell nicht oder nur äußerst beschwerlich: „Witwen und Witwer“, „Ärzte und Ärztinnen“, „Mädchen und Jungen“ etc. Nicht nur in solchen Fällen bieten sich alternative Formen an, die grammatisch oder semantisch, also in ihrer Bedeutung, das Problem umgehen. Zum Beispiel können Partizipformen helfen: „die Verwitweten“, „die Studierenden“. Oder es werden andere Begriffe gefunden: „Mediziner(innen)“, um die Form „Ärzt(inn)e(n) zu vermeiden, die konsequent wäre; „Kinder“ (um die Doppelnennung „Mädchen und Jungen“ zu umgehen).
Vorteil:
Beide Geschlechter werden repräsentiert, Dopplungen vermieden und bereits festgelegte Stile wie Klammern können konsequent durchgehalten werden.
Nachteil:
Nicht für alle Bezeichnungen gibt es entsprechende Begriffe. Gerade in Fachsprachen kann das zulasten der Präzision gehen – sind „Kaufende“, „Mietende“ und „Wählende“ wirklich synonym zu „Käufer(inne)n“, „Mieter(inne)n“ und „Wähler(inne)n“?
Aufgabenbeschreibung
Die folgenden Satzbeispiele enthalten stilistische Mängel oder Ungenauigkeiten (und sind alle aus Texten, die kurz vor der Publikation noch einmal lektoriert und hier teilweise verfremdet wurden). Im Eingabefeld können Sie sich ausprobieren und die Sätze nach Belieben umbauen. Tipp: Seien Sie bei schwierigen Fällen konsequent und formulieren Sie den gesamten Satz neu, statt nur einzelne Teile zu „reparieren".
Gender Übung 1
Eine signifikante Zahl an Studenten denkt bereits während des Studiums über berufliche Perspektiven nach und plant den Berufseinstieg.
Eine signifikante Zahl Studierender denkt ...
Wenn es eine Möglichkeit gibt, das "Genderproblem" begrifflich zu umgehen, sollte dieser Weg gewählt werden. Das aktivische Wort "Studierende" hebelt das Problem des generischen Maskulinums aus.
Aufgabenbeschreibung
Die folgenden Satzbeispiele enthalten stilistische Mängel oder Ungenauigkeiten (und sind alle aus Texten, die kurz vor der Publikation noch einmal lektoriert und hier teilweise verfremdet wurden). Im Eingabefeld können Sie sich ausprobieren und die Sätze nach Belieben umbauen. Tipp: Seien Sie bei schwierigen Fällen konsequent und formulieren Sie den gesamten Satz neu, statt nur einzelne Teile zu „reparieren".
Gender Übung 2
Wenn frau sich den Koalitionsvertrag ansieht, fallen doch einige Unklarheiten ins Auge.
Wenn man sich den Koalitionsvertrag ansieht, fallen doch einige Unklarheiten ins Auge.
Wenn man sich als Frau den Koalitionsvertrag ansieht, fallen doch einige Unklarheiten [in Bezug auf Fragen der Gleichberechtigung] ins Auge.
Das Wort „man" (klein und mit einem „n") geht sprachgeschichtlich auf „Mensch" und nicht auf den „Mann" zurück. Es hat also der Sache nach wenig mit dem generischen Maskulinum zu tun. Es durch ein klein geschriebenes „frau" zu ersetzen, ist daher unnötig und zudem orthographisch falsch.
Aufgabenbeschreibung
Die folgenden Satzbeispiele enthalten stilistische Mängel oder Ungenauigkeiten (und sind alle aus Texten, die kurz vor der Publikation noch einmal lektoriert und hier teilweise verfremdet wurden). Im Eingabefeld können Sie sich ausprobieren und die Sätze nach Belieben umbauen. Tipp: Seien Sie bei schwierigen Fällen konsequent und formulieren Sie den gesamten Satz neu, statt nur einzelne Teile zu „reparieren".
Gender Übung 3
Die Gäste und Gästinnen waren, allem Anschein nach, sehr zufrieden.
Die Gäste waren, allem Anschein nach, sehr zufrieden.
„Der Gast" ist ähnlich wie „der Baum" zu verstehen, also eigentlich kein generisches Maskulinum. „Gästinnen" wäre dann eine klassische Hyperkorrektur, genauso wie „GästInnen". Seit Kurzem allerdings führt der Duden das Wort „Gästin" als feminine Form zu Gast, markiert es allerdings als selten bzw. wenig üblich. Hier betreten wir genderpolitisches Fahrwasser, weil es mittlerweile möglich ist, „Gästin" zu schreiben.