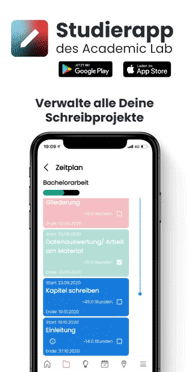Oral History
Oral History ist eine Methode der Geschichtswissenschaft, bei der ZeitzeugInnen zu bestimmten Ereignissen befragt und von den InterviewerInnen möglichst wenig beeinflusst werden sollen. Die entstandenen Narrationen geben Auskunft über einen historischen Sachverhalt oder bestimmte Zusammenhänge und Deutungen. Ursprünglich war Oral History gedacht als reine Erzählung der ZeitzeugInnen, also gänzlich ohne Nachfragen, damit nicht Deutungen oder Schwerpunkte des Forschers oder der Forscherin die Aussagen verzerren. Mittlerweile allerdings wird Oral History eher als reguläre Interviewtechnik in der Geschichtswissenschaft verstanden, was der Methode gewissermaßen die Eigenheit raubt.
Zu beachten ist allerdings, dass die Aussagen von ZeitzeugInnen mit Vorsicht zu betrachten sind. Sie sind keinesfalls eindeutige und damit wahre Widerspiegelungen historischer Tatsachen. Dafür gibt es viele Gründe.
- Eine subjektive Sprecherposition liefert immer nur subjektive Einsichten. Dies ist zwar eine banale Aussage, im Kontext von Methoden aber dennoch bedeutsam.
- Erinnerung ist ein kompliziertes Phänomen. Menschen speichern nicht einfach Erinnerungen, sondern verknüpfen sie unablässig mit dem jeweils aktuellen Kontext. Anders formuliert: Erinnerungen verändern sich mit der Zeit und können Geschehnisse sehr unterschiedlich aussehen lassen. Sie sind also, methodisch beschaut, nicht tatsächlich authentisch (was nicht heißt, dass sie gefälscht oder erlogen sind). Theoretisch spricht man von retroaktiver Kausalität. Erinnerungen werden vom Erzähler oder von der Erzählerin immer erst im Moment der Erzählung rekonstruiert, was auch heißt: Vergangenes wird aus der Gegenwart heraus gedeutet und beurteilt.
- Materialien, die auf diese Weise gewonnen werden, sind nicht einfach auszuwerten. Mitunter geht es aber nicht um die Frage, was wirklich geschah, sondern darum, wie eine Person über bestimmte Dinge – und über sich selbst – Auskunft gibt oder Rechenschaft ablegt. Die Forschungsfrage bedingt die Auswertungsperspektive und die Entscheidung, ob Oral History für die Beantwortung der Frage geeignet ist oder nicht.
- Niethammer, Lutz (1980): Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die Praxis der „Oral History“. Frankfurt/Main: Syndikat.