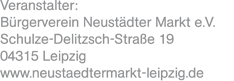| Anja Mannecke | ||
| Anne Luise Weber | ||
| Bettina Naumann | ||
| Christin Baumann und Nicole Kwiatkowski | ||
| Hanna Mock | ||
| Karolin Müller | ||
| Kathleen Hegenbarth | ||
| Melanie Watzlawek | ||
| Nicole Kwiatkowski | ||
| Rebecca Fleckeisen und Andrea Schumann | ||
| Ronja Guth | ||
| Sarah Neufeld und Sophie Girwert | ||
| Simon Rosenow und Christian Rug | ||
|
Anja Mannecke »vollkommene Unvollkommenheit«  Das Schöne ist oft nur augenscheinlich schön, und an vielen aber weniger-sichtbaren Ecken
hässlich. So merkwürdig es klingt, dieses »Hässliche im Schönen« ist enttäuschender als das
»Hässliche im Hässlichen«, da das Schöne andere Erwartungen aufbaut als das Hässliche oder
Unvollkommene.
Das Schöne ist oft nur augenscheinlich schön, und an vielen aber weniger-sichtbaren Ecken
hässlich. So merkwürdig es klingt, dieses »Hässliche im Schönen« ist enttäuschender als das
»Hässliche im Hässlichen«, da das Schöne andere Erwartungen aufbaut als das Hässliche oder
Unvollkommene.
Nicht nur deswegen »besitzt« das Unvollkommene mehr Potenzial als das Schöne und hat dementsprechend viel mehr »Reserven« um zu überraschen und zu begeistern. Die Bewertung »schön« oder »hässlich« ist nicht nur dem Auge des Betrachters »unterworfen« sondern auch der Zeit. Dinge die ehemals als modern und schön galten, sind heute veraltet und hässlich und Etwas das als veraltet und hässlich galt, kann plötzlich wieder als liebenswert und schön empfunden werden. Zwischen schön und hässlich gibt es einen ständigen Wandel. Dieser Faktor der Zeit macht sich noch stärker im Kreislauf des Natürlichen bemerkbar, da das natürliche Schöne noch schneller verwelkt bzw. verwest und zu etwas wird, das die meisten nicht mehr als Schön empfinden, aus dem aber oft wieder etwas Neues und Schönes hervorgeht. Der Raum spielt nicht nur mit dem subjektive Empfinden von schön und hässlich sondern versucht auch den Faktor Zeit in diesem Zusammenhang einzubinden. Besucher welche sich die Zeit nehmen, um den Raum ein paar Tage später erneut zu besuchen, könnten einen Wandel des Raumes erleben. Des weiteren befindet sich dieser Raum nicht nur in Neuschönefeld, sondern möchte auch auf dessen Wandel aufmerksam machen. Da über das Viertel doch noch einige längst überholte Klischee verfestigt sind, lädt er dazu ein dieses zwar unvollkommene aber charmante und ungekünstelte Viertel, außerhalb dieses Raumes zu betrachten, um subjektiv über »schön und hässlich« urteilen zu können. Das Vollkommene wäre nur dann vollkommen wenn es alle als solches empfinden würden. Da aber jeder ein anderes Bild von Dem was vollkommen ist hat, gibt es das Vollkommene nicht. Das Unvollkommene + den Freiraum den es durch seine Unvollkommenheit der Fantasie bietet, ist folglich dem Vollkommen näher als etwas das vermeintlich vollkommen ist. |
||
|
| nach oben | |
||
|
Anne Luise Weber »Ferne Nähe«  Ausgangspunkt meiner Arbeit sind die fotografierten Innenraumecken einer Leipziger Galerie. Aus diesen Ecken entstand am Computer ein neues Bild, eine Fotomontage.
Dabei war es meine Absicht, einen Teil des etablierten Ausstellungsraums in etwas Neues zu transformieren, um dann das entstandene im Pöge-Haus - ein von der Kunst
kaum erschlossener Raum - anzubringen.
Ausgangspunkt meiner Arbeit sind die fotografierten Innenraumecken einer Leipziger Galerie. Aus diesen Ecken entstand am Computer ein neues Bild, eine Fotomontage.
Dabei war es meine Absicht, einen Teil des etablierten Ausstellungsraums in etwas Neues zu transformieren, um dann das entstandene im Pöge-Haus - ein von der Kunst
kaum erschlossener Raum - anzubringen.
Erst im Prozess stellte sich heraus, dass der Raum für den ich mich im Pöge-haus entschieden habe, für meine Arbeit eine größere Rolle spielt. Er übernimmt zwei Bedeutungsebenen: Das Bild vom Raum, in welchem wiederum ein Bild auftaucht, verweist zum einen explizit auf den Ausstellungsraum in dem sich die Arbeit befindet und unterstreicht so seinen Bedeutungsgehalt - die Nutzbarmachung des Leerstandes als Kunstraum. Andererseits distanziert der abgebildete Raum den Betrachter von der »eigentlichen« Arbeit, der Ecken-Collage. Das Ecken-Bild bleibt unzugänglich, wie im Selbstschutz, behält aber gleichzeitig seine Autonomie. Die leicht nach links gerichtete Ausrichtung der skulpturalen Figur verstärkt dabei noch den Eindruck von Distanz. Diese Darstellungsform visualisiert die Gedanken und Fragen die mich im Bezug zum Pöge-Haus, der darin stattfindenden Ausstellung und dem eigenen künstlerischen Schaffen beschäftigt haben. Ist das Pöge-Haus tatsächlich ein geeigneter Ort um »Kunst« zu präsentieren, oder fehlt es den Räumen an Neutralität? Wie beeinflussen sich Raum und Bild gegenseitig? Welche Bedeutung hätte die Arbeit an einem anderen Ort? Wie würde sich ihr Sinngehalt verändern? Die Reproduktion des Raumes als Bild im Bild spielt auch mit der Wahrnehming des Betrachters und dem Wirklichkeitsbegriff. Welchen Zweck erfüllt die Wiedergabe der Zimmeransicht? Wie »wirklich« ist das Ecken-Bild, welches zwar zentral im Bild erscheint, aber dennoch nur Abbild/Widerholung bleibt? Die Arbeit beantwortet all diese Fragen nur ansatzweise und lässt somit dem Besucher genügend Raum für eine eigene Sichtweise und Auslegung der Arbeit. |
||
|
| nach oben | |
||
|
Bettina Naumann »Laufweise«  Schuhe haben vor allem einen praktischen Nutzen, sie dienen dem Schutz der Füße, um Verletzungen auf steinigem,
oder mit spitzen oder harten Gegenständen bedecktem Boden zu vermeiden. Sie schützen die Füße vor Schmutz und Nässe, vor Kälte, Hitze oder Verbrennungsgefahr.
Schuhe haben vor allem einen praktischen Nutzen, sie dienen dem Schutz der Füße, um Verletzungen auf steinigem,
oder mit spitzen oder harten Gegenständen bedecktem Boden zu vermeiden. Sie schützen die Füße vor Schmutz und Nässe, vor Kälte, Hitze oder Verbrennungsgefahr.
Wanderschuhe, Laufschuhe, Sneakers, Pantoletten, Flip Flops, Sandalen, Tanzschuhe, Lackschuhe, Hausschuhe, Sportschuhe, Arbeitsschuhe, Gummistiefel, Lederstiefel,-das Repertoire des heutigen Schuhs ist allzu vielfältig. Schuhe sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Kleidung und können dazu beitragen, ihrem Träger eine Identität zu verschaffen, sei es im Sport, als Kennzeichen für eine bestimmte Szenenzugehörigkeit, oder etwa als modischer, eleganter Schuh harmonierend mit der Abendgarderobe. Mit Schuhen geht man von Ort zu Ort, Schuhbesitzer treffen sich, reden, kommunizieren, tanzen miteinander. »Laufweise« zeigt Schuhe verschiedenster Art in Form von Schrittfolgen durch zwei Räume. Die Schritte laufen, ausgehend von den Fenstern des zum Hof zeigenden Raumes die Wände entlang, über den Boden und über die Decke, Schritte, die einander folgen und damit eine Route, einen Migrationspfad bilden. In einem Punkt treffen sie sich, als würden sie miteinander kommunizieren. Über die Fenster des zur Straße zeigenden Raumes verlassen sie den Ort wieder. Die Arbeit soll unterschiedliche Schuhbesitzer, und damit Menschentypen veranschaulichen, welche einen gemeinsamen Weg gehen, sich treffen, miteinander ins Gespräch kommen und den Ort wieder verlassen. |
||
|
| nach oben | |
||
|
Christin Baumann und Nicole Kwiatkowski »W E G« 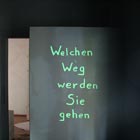 Tagtäglich sind die Straßen Leipzigs durch Menschen belebt, die entweder zur Arbeit müssen, Besorgungen machen, spazieren gehen
oder auf dem Heimweg sind. Diesen Aspekt übertrugen wir speziell auf den Stadtteil Leipzig Neustadt, wobei der dazugehörige Neustädter Markt bzw.
die Kirche mit dem gegenüberliegenden Pögehaus im Mittelpunkt steht. An diesem Ort stellten wir den Bewohnern des Stadtteils die Frage:
Welchen Weg werden sie gehen? Und zeichneten die Antworten zugleich mit dem Tonband auf.
Tagtäglich sind die Straßen Leipzigs durch Menschen belebt, die entweder zur Arbeit müssen, Besorgungen machen, spazieren gehen
oder auf dem Heimweg sind. Diesen Aspekt übertrugen wir speziell auf den Stadtteil Leipzig Neustadt, wobei der dazugehörige Neustädter Markt bzw.
die Kirche mit dem gegenüberliegenden Pögehaus im Mittelpunkt steht. An diesem Ort stellten wir den Bewohnern des Stadtteils die Frage:
Welchen Weg werden sie gehen? Und zeichneten die Antworten zugleich mit dem Tonband auf.In dem vollständig schwarzen Eingangsbereich sind die geschilderten Wege zu hören. Lediglich befindet sich eine Fragen an der Wand: Welchen Weg werden Sie gehen?  Im zweiten Raum,welcher sich in einem weißen Zustand befindet, wurde das Straßennetz des Viertels auf dem Boden sowie an den Wänden verzeichnet.
Die Kirche an dem Neustädter Markt, welche vom Fenster aus zu sehen ist, dient als visueller Fixpunkt. Im Vorfeld wurden die aus dem
Interview entnommenen Wege von uns selbst grün eingezeichnet. Aber auch die Besucher der Ausstellung sollen ihren weg, welchen sie gegangen sind,
rot darstellen. Auch die Ambivalenz des Titels soll noch einmal auf die beiden gegensätzlichen Fragen verweisen.
Im zweiten Raum,welcher sich in einem weißen Zustand befindet, wurde das Straßennetz des Viertels auf dem Boden sowie an den Wänden verzeichnet.
Die Kirche an dem Neustädter Markt, welche vom Fenster aus zu sehen ist, dient als visueller Fixpunkt. Im Vorfeld wurden die aus dem
Interview entnommenen Wege von uns selbst grün eingezeichnet. Aber auch die Besucher der Ausstellung sollen ihren weg, welchen sie gegangen sind,
rot darstellen. Auch die Ambivalenz des Titels soll noch einmal auf die beiden gegensätzlichen Fragen verweisen.
Am Ende wird ein dichtes Netz zu sehen sein. Wege, die parallel verlaufen, sich kreuzen oder voneinander wegführen. Aber alle verbindet ein Wesentliches, der Neustädter Markt. |
||
|
| nach oben | |
||
|
Hanna Mock »Zu Hause – zu Hause?«  Das Zuhause - ein Ort?
Das Zuhause - ein Ort?Ein Raum, ein Haus, eine Stadt, ein Land? Das Zuhause - kein Ort? Ein Gefühl, eine Erfahrung, eine Erinnerung, eine Utopie? Ein »Zuhause« wird konstruiert und darauf gewartet, dass seine Bewohner zu wachsen beginnen. Oft versteht man erst in der Fremde, wo man eigentlich zu Hause ist. Durch Abgrenzung zu Anderem wird bewusst, was das Besondere an diesem ist. Der Raum, den man bewohnt, bedeutet noch lange nicht das gleiche Gefühl. Ein Wohn-Raum bietet Schutz und kann ganz individuell gestaltet werden. Er bietet eine Grundlage für ein »Zuhause« Gefühl. Dennoch kann er auch als rein konstruiert betrachtet werden, denn die Fotos an der Wand und die Lampe an der Decke sind noch lange kein Grund um Wurzeln zu schlagen. Die Tapetenschichten an der Wand zeugen von früheren Bewohnern des Raumes. Sie haben den Raum bewusst gestaltet und ihm damit eine ganz eigene Atmosphäre verliehen. Ein Versuch, das Zuhause selbst zu erschaffen? |
||
|
| nach oben | |
||
|
Karolin Müller »Der Tropfen und der heiße Stein«  Die oberste Etage des Pöge-Hauses ist teilweise stark beschädigt.
Durch kleine Schäden am Dach ist das Mauerwerk porös und die Decke instabil.
Im hinteren der beiden Räume, welche ich für die Installation gewählt habe, ist der Verfall so weit fortgeschritten,
dass sich der Putz von der Decke gelöst hat, wo nun Löcher klaffen. Ich verwende den Raum weitgehend wie ich ihn vorgefunden habe.
Auf dem Fußboden des Raumes werden eine Vielzahl von verschiedenen Gefäßen stehen, welche ich im Haus gesammelt habe.
Überbleibsel von ehemaligen Bewohnern und Ausstellungen vergangener Jahre. Dadurch arbeite ich nur mit Materialien, die etwas mit dem Ort des Geschehens zu tun haben.
Die Gefäße werden mit Wasser gefüllt.
Die oberste Etage des Pöge-Hauses ist teilweise stark beschädigt.
Durch kleine Schäden am Dach ist das Mauerwerk porös und die Decke instabil.
Im hinteren der beiden Räume, welche ich für die Installation gewählt habe, ist der Verfall so weit fortgeschritten,
dass sich der Putz von der Decke gelöst hat, wo nun Löcher klaffen. Ich verwende den Raum weitgehend wie ich ihn vorgefunden habe.
Auf dem Fußboden des Raumes werden eine Vielzahl von verschiedenen Gefäßen stehen, welche ich im Haus gesammelt habe.
Überbleibsel von ehemaligen Bewohnern und Ausstellungen vergangener Jahre. Dadurch arbeite ich nur mit Materialien, die etwas mit dem Ort des Geschehens zu tun haben.
Die Gefäße werden mit Wasser gefüllt.
Im vorderen Raum, den man zuerst betritt wird eine Klanginstallation laufen. Es werden Tropfen zu hören sein. Dieser Raum ist allerdings völlig leer und äußerlich noch relativ gut erhalten. Der Bogen schließt sich somit erst nach durchlaufen des ersten Raumes und mit dem Erblicken des Verfalls und der Gefäße im zweiten Raum. Der Betrachter soll selbst entscheiden wie er die Eindrücke interpretiert und was sie für Ihn bedeuten. Es ist allerdings gewünscht, dass durch die Vielzahl von Gefäßen, die zum Teil zerbrochen sind und die Verhältnismäßige Übermacht des Wassers und des Verfalls ein Gefühl der Machtlosigkeit erzeugt wird. Aus meiner Sicht wird dargestellt, dass die vorhandenen Mittel oft nicht ausreichen um wieder gut zu machen, was schon vor Jahren hätte passieren können. Wenn man so möchte ist diese Auslegung übertragbar auf sämtliche Lebensbereiche. Die Arbeit zeigt den Verfall, die Stetigkeit und das beharrliche und vergebliche Bemühen. Ein Tropfen auf den heißen Stein. |
||
|
| nach oben | |
||
|
Kathleen Hegenbarth »ANDERS NEU«  Immer wieder kommen wir an Orte, welche uns neu sind - wo wir nichts kennen - wo wir uns fremd oder doch auf eine Art und Weise heimisch fühlen.
Wie kommt dieses Gefühl von Abneigung oder Geborgenheit zustande? Individuell versucht jeder einen Ort für sich zu erschließen bzw.
macht sich ein Bild davon, aber welche Aspekte fließen dabei in unsere Urteilsfindung ein? Was nehmen wir mehr, was weniger wahr?
Immer wieder kommen wir an Orte, welche uns neu sind - wo wir nichts kennen - wo wir uns fremd oder doch auf eine Art und Weise heimisch fühlen.
Wie kommt dieses Gefühl von Abneigung oder Geborgenheit zustande? Individuell versucht jeder einen Ort für sich zu erschließen bzw.
macht sich ein Bild davon, aber welche Aspekte fließen dabei in unsere Urteilsfindung ein? Was nehmen wir mehr, was weniger wahr?

Auf Grundlage einer zuvor festgelegten Route habe ich für mich dieses - mir bisher fremde - Viertel erschlossen und die gewonnenen Eindrücke in entsprechender Form dokumentiert. Und wie nimmst du deine Umgebung wahr? |
||
|
| nach oben | |
||
|
Melanie Watzlawek »SCHEIN und SEIN«  Außen/Innen,
Außen/Innen,Oberfläche/Kern, Auftreten/Absicht, Schein/Sein Zu sehen ist eine Schmuckausstellung mit verschiedenen Schmuckserien. Es ist Schmuck aus frischem Gemüse, mit Gold und Perlenstaub veredelt. Es gibt vor etwas dauerhaft Kostbares und Wertvolles zu sein, zeigt aber innerhalb kurzer Zeit seine Vergänglichkeit und damit seinen Kern - es schrumpelt, vielleicht fault es sogar unter der Lackschicht.  Oft stimmen Schein und Sein nicht überein. Nicht nur im klischeehaften "Außen hui, Innen pfui", sondern auch auf der Ebene der Einstellungen und der Werte.
Bin ich authentisch? Stimmen meine Worte und meine Taten überein? Aber auch in der Lebensgestaltung, im Hinblick auf meine Ziele und Vorstellungen.
Folge ich meinem Potenzial oder mache ich einfach irgendetwas um zu (über)leben und zu funktionieren?
Oft stimmen Schein und Sein nicht überein. Nicht nur im klischeehaften "Außen hui, Innen pfui", sondern auch auf der Ebene der Einstellungen und der Werte.
Bin ich authentisch? Stimmen meine Worte und meine Taten überein? Aber auch in der Lebensgestaltung, im Hinblick auf meine Ziele und Vorstellungen.
Folge ich meinem Potenzial oder mache ich einfach irgendetwas um zu (über)leben und zu funktionieren?
|
||
|
| nach oben | |
||
|
Nicole Kwiatkowski »BEWEGTE BILDER«  Jeden Tag sind wir von Menschen umgeben, die wir kennen und die uns vertraut sind aber auch von Menschen, die uns völlig fremd sind.
Manche sehen wir nur flüchtig und trotzdem hinterlassen sie eine kleine Spur.
Für jenen kurzen Moment haben wir nur ihre Gesten und Mimik wahrgenommen, doch diese scheinen entscheidend gewesen zu sein um uns für
einen Augenblick in einer Art Kommunikation mit ihnen zu fühlen.
Jeden Tag sind wir von Menschen umgeben, die wir kennen und die uns vertraut sind aber auch von Menschen, die uns völlig fremd sind.
Manche sehen wir nur flüchtig und trotzdem hinterlassen sie eine kleine Spur.
Für jenen kurzen Moment haben wir nur ihre Gesten und Mimik wahrgenommen, doch diese scheinen entscheidend gewesen zu sein um uns für
einen Augenblick in einer Art Kommunikation mit ihnen zu fühlen.
Solch ein Moment war für mich Grund genug, um mich tiefer auf ihn einzulassen und Situationen zu finden, die solche Momente widerspiegeln. Gefunden habe ich diese nicht nur in den Gesichter der Menschen, die mir begegneten, sondern auch in einem Augenblick der Bewegung. In einer besonderen Bewegung...im Tanz....denn Tanz tröstet, aktiviert die Sinne, belebt, vermittelt Gemeinschaft, fördert das Selbstbewusstsein und ermöglicht einen direkten Zugang zu Gefühlen. Tanz ist ein Medium, das dabei helfen kann, die Signale des Körpers und die innere Stimme ernst zu nehmen und ihnen Ausdruck zu verleihen  Dazu gehört auch die Mimik des Gesichts, sie dient der nonverbalen Kommunikation und dem Ausdruck von Gefühlen, vor allem aber dazu persönliche Eigenschaften eines Menschen auszudrücken.
Doch nur bestimmte Gefühle haben einen universalen Gesichtsausdruck bei vielen Menschen.
Das Mienenspiel des Gesichts dient damit auch der bewussten Selbstdarstellung und Selbstinszenierung --- Selbstdarstellung und
Selbstinszenierung sind auch im Tanz grundlegende Ausdrucksmittel
Dazu gehört auch die Mimik des Gesichts, sie dient der nonverbalen Kommunikation und dem Ausdruck von Gefühlen, vor allem aber dazu persönliche Eigenschaften eines Menschen auszudrücken.
Doch nur bestimmte Gefühle haben einen universalen Gesichtsausdruck bei vielen Menschen.
Das Mienenspiel des Gesichts dient damit auch der bewussten Selbstdarstellung und Selbstinszenierung --- Selbstdarstellung und
Selbstinszenierung sind auch im Tanz grundlegende Ausdrucksmittel
In unser heutigen Zeit ist die Sprache das wichtigste und meist gebrauchte Kommunikationsmittel der Menschen. Sie ermöglicht es, Gedanken und Gefühle zum Ausdruck zu bringen und sich anderen Menschen mitzuteilen. Die Mimik bringt seelische Erlebnisse über eine körperliche Erscheinungsform zum Ausdruck. Dem Gesicht kommt daher eine größere Aufmerksamkeit, als dem übrigen Körper zu, weil es zuerst und ganzheitlich an anderen Menschen wahrgenommen und meist länger als vieles andere von ihnen im Gedächtnis behalten wird. - im Tanz jedoch ist der Körper ausschlaggebend Das Gesicht ist primärer Schauplatz für die Darstellung von Emotionen und kann mitteilen, was man in Bezug auf den Inhalt seiner sprachlichen Äußerungen fühlt - natürlich keineswegs immer genau, da Gesichter im Hinblick auf Gefühle lügen können. --- auch die Körpersprache im Ausdruckstanz gleicht dieser Beschreibung, denn es ist möglich seine Emotionen im Tanz zu verbergen ...es ist aber genau so gut möglich seine Emotionen zu offenbaren ohne sich rechtfertigen zu müssen Es ist wahr, dass die Verständigung durch Worte oft künstlich und distanziert erscheint und erst durch die Untermalung von Gestik und Mimik einen wahren Sinngehalt bekommt, denn die spontanen Reaktionen unseres Körpers haben wir nie so sehr unter Kontrolle wie unsere Worte. --- diese spontanen Reaktionen des Körpers kann man im Tanz erleben und fühlen, denn hier ist es möglich diese Reaktion noch intensiver auszudrücken und zu leben |
||
|
| nach oben | |
||
|
Rebecca Fleckeisen und Andrea Schumann »Baustelle - Abstraktion im Tun«  In der dritten Etage, im ausschließlich weiß gehaltenen Raum stehen vier Objekte zur Ansicht, die abstrahiert konstruiert wurden.
Bei diesen Objekten haben wir uns von dem Künstler Sol LeWitt inspirieren lassen. Dabei wollten wir das ihm eigene Prinzip aufnehmen,
welches beinhaltet, dass Form und Raum sich gegenseitig durchdringen (damit sollen Innenraum und Außenraum in Szene gesetzt werden und eine optimale Synthese bilden).
Hierbei haben wir uns an markanten Gebäuden des Viertels Neustadt-Neuschönefeld orientiert, welche dann auf ihre Grundelemente reduziert wurden
In der dritten Etage, im ausschließlich weiß gehaltenen Raum stehen vier Objekte zur Ansicht, die abstrahiert konstruiert wurden.
Bei diesen Objekten haben wir uns von dem Künstler Sol LeWitt inspirieren lassen. Dabei wollten wir das ihm eigene Prinzip aufnehmen,
welches beinhaltet, dass Form und Raum sich gegenseitig durchdringen (damit sollen Innenraum und Außenraum in Szene gesetzt werden und eine optimale Synthese bilden).
Hierbei haben wir uns an markanten Gebäuden des Viertels Neustadt-Neuschönefeld orientiert, welche dann auf ihre Grundelemente reduziert wurden(Bsp.: Kirche mit Dreiecksformen). Im Workshop, der am 20. 06. 2010 stattfand, sollte gemeinsam mit den Teilnehmern ein viertes Objekt enstehen, welches entweder frei erfunden wurde oder sich ebenfalls an einem der Anwohner bekannten Gebäude ausrichtet. |
||
|
| nach oben | |
||
|
Ronja Guth »Der schöne Schein«  Seit einiger Zeit beschäftigt mich das Thema »Der schöne Schein«.
Seit einiger Zeit beschäftigt mich das Thema »Der schöne Schein«.
Wie wirken Dinge auf uns und was steckt hinter diesen Dingen, wenn man einen genaueren Blick wagt? Was wird aus dem schönen Schein? Bleibt etwas von ihm übrig? Oftmals trügt der Schein... und genau das sollen die Origami-Möbel – zunächst wie echte, benutzbare Möbel erscheinen, doch bei einem zweiten Blick sollen sie enttarnt werden können. Jedes der Origami kann nach gebaut werden und so als Gedankenstütze dienen, dass wir viel öfters einen zweiten Blick riskieren sollten. Ich möchte mit dieser Arbeit dazu anregen im Alltag genauer hin zuschauen, es nicht beim ersten Blick zu belassen. |
||
|
| nach oben | |
||
|
Sarah Neufeld und Sophie Girwert »Puppenstube«  In unserer Arbeit gingen wir von folgender Grundthematik aus: Die Sexualisierung des weiblichen Körpers und das daraus resultierende Frauenbild in der Gesellschaft.
In unserer Arbeit gingen wir von folgender Grundthematik aus: Die Sexualisierung des weiblichen Körpers und das daraus resultierende Frauenbild in der Gesellschaft.
Für die entstandene Installation spielte besonders die Barbie-Puppe eine tragende Rolle. Sie steht mit ihrem sexistischen unnatürlichen Äußeren für frühkindliche Prägung im Bezug auf das vorherrschende Schönheitsideal und genauso auch für kindliches unschuldiges Spiel, das wir in unserer Arbeit bewusst dem »ErwachsenenSpiel« gegenüberstellen. Die »Sexdoll« integrierten wir in die Installation, weil sie optisch auffällige Parallelen zur Barbie auffweist und somit regelrecht eine pervertierte Form dieser darstellt. Abgedunkelte Fenster, künstliche diffuse Beleuchtung und die verspiegelte Wand sollen die Situation bedrohlicher, erdrückender wirken lassen und somit die scheinbare Ausweglosigkeit im Schönheits-und Geschlechterkampf demonstrieren. Die antiästhetische Arbeit mit schwarzem Isolierband erinnert sowohl an den Zensurbalken, den wir aus den Medien kennen, wie auch an Fesselungen. Der Raum ist nur durch ein Guckloch an der Tür einsichtbar, was an ein heimliches Beobachten durchs Schlüsselloch erinnern soll: Etwas geschieht hinter verschlossenen Türen. Die Installation steht somit als Bild im Raum und ermöglicht eine distanzierte Sichtweise auf die Arbeit und lässt genügend Raum für verschiedene Gedanken. Diese können im »Beobachtungsraum« in die an der Wand befestigten Magazine niedergeschrieben werden. |
||
|
| nach oben | |
||
|
Simon Rosenow und Christian Rug o. T.  Bedeutung des Motivs:
Bedeutung des Motivs:
Ein kleines Mädchen sitzt vor einem großen, grünen Klecks, der auch gleichbedeutend für ein Dorf oder aber auch für ein ganzes Land stehen könnte. Das Mädchen hält einen Pinsel in der Hand und versucht ihr Land nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten - vielleicht versucht es aber auch, das Land, so wie es im Moment existiert, zu zerstören. Das Grün des Kleckses ist dabei sehr prägnant. Grün steht für Leben, für Erneuerung und für Hoffnung - Hoffnung auf Selbstgestaltung seines Lebens, auf Gleichheit und ein Leben in Frieden und Freiheit.  Ihr gegenüber bewegt sich ein Soldat auf sie zu, der in Größe und Statur das Kind überragt. Man kann jedoch nicht erkennen, wem der Soldat dient:
Ist er ein UN-Blauhelm, Angehöriger der Friedenstruppen, Soldat einer staatlichen Arme oder Kämpfer einer Miliz?
Ihr gegenüber bewegt sich ein Soldat auf sie zu, der in Größe und Statur das Kind überragt. Man kann jedoch nicht erkennen, wem der Soldat dient:
Ist er ein UN-Blauhelm, Angehöriger der Friedenstruppen, Soldat einer staatlichen Arme oder Kämpfer einer Miliz?
Fragenstellung: Zwangsläufig stellt man sich verschieden Fragen: Kommt er, um das Kind zu vertreiben, oder um zu helfen? Welche Rolle spielt der Soldat im Leben des Kindes oder aber (versteht man das Kind stellvertretend für ganze Volksgruppen) auch die Armee im Leben vieler Flüchtlinge, die ihr Heimatland aus Kriegsgründen, Hungersnöten, Naturkatastrophen oder anderen Ereignissen verlassen mussten? |
||
|
| nach oben | |
||