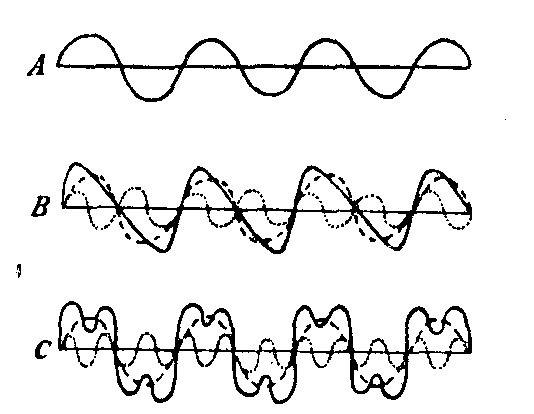
Fig. 9. Klangformen. A einfache pendelartige Schwingungen.
B u. C zusammengesetzte Klangformen (B
Grundton und erster, C Grundton u. zweiter Oberton).
l. Eine Verbindung von Empfindungen, in der jedes Element an irgendein zweites genau in derselben Weise wie an jedes beliebige andere gebunden ist, nennen wir eine intensive Vorstellung. In diesem Sinn ist z. B. der Zusammenklang der Töne dfa eine solche. In der unmittelbaren Auffassung sind die Einzelverbindungen, in die sich dieser Zusammenklang zerlegen läßt, in welcher Ordnung man sich dieselben auch denken mag, wie df, da oder fd, fa oder ad, af, einander vollkommen gleichwertig. Die intensiven Vorstellungen lassen sich daher auch als Verbindungen von Empfindungselementen in beliebig permutierbarer Ordnung definieren.
Infolge dieser Eigenschaft gibt es bei den intensiven Vorstellungen keine aus der Verbindungsweise der Empfindungen entspringenden Merkmale, mittels deren sie sich in einzelne Teile zerlegen lassen, sondern eine solche Zerlegung ist hier immer nur auf Grund der Verschiedenheit der konstituierenden Empfindungen selbst möglich. So unterscheiden wir die Elemente des Zusammenklangs dfa nur deshalb, weil wir in diesem die qualitativ verschiedenen Töne d, f und a hören. Dagegen sind diese einzelnen Elemente innerhalb der einheitlichen Vorstellung des Ganzen weniger deutlich unterscheidbar als in ihrem isolierten Zustande. Dies Zurücktreten, welches bei allen Sinneswahrnehmungen eine wichtige Rolle spielt, bezeichnen wir allgemein als Verschmelzung der Empfindungen, und speziell bei den intensiven Vorstellungen als intensive Verschmelzung. Ist die Verbindung eines Elements mit andern Elementen eine so innige, daß es nur durch eine ungewöhnliche Richtung der Aufmerksamkeit, unterstützt durch die experimentelle Variation der Bedingungen, in dem Ganzen wahrnehmbar ist, so nennen wir die Verschmelzung eine vollkommene; tritt dagegen das Element nur gegenüber dem Eindruck des Ganzen zurück, während es doch in der ihm eigenen Qualität unmittelbar erkennbar bleibt, so nennen wir sie eine unvollkommene. Treten endlich bestimmte Elemente mehr als andere in der ihnen eigentümlichen Qualität hervor, so nennen wir diese die herrschenden Elemente. Der Begriff der Verschmelzung in dem hier definierten Sinn ist demnach ein rein psychologischer Begriff, dem in der Reihe der "Assoziationen" seine durch die angegebenen Merkmale bezeichnete Stelle anzuweisen ist. (Vgl. § 16, 4.)
In der Wirklichkeit gehen nun alle intensiven Vorstellungen immer zugleich gewisse räumliche und zeitliche Verbindungen ein. So ist uns z. B. ein Zusammenklang stets als ein in der Zeit dauernder Vorgang gegeben, den wir zugleich, wenn auch häufig nur unbestimmt, auf irgendeine Richtung im Raum beziehen. Aber da diese zeitlichen und räumlichen Eigenschaften bei gleicher intensiver Beschaffenheit der Vorstellungen beliebig wechseln können, so abstrahieren wir von ihnen bei der Untersuchung der intensiven Eigenschaften der Vorstellungen.
2. Bei den Vorstellungen des allgemeinen Sinnes kommen intensive Verschmelzungen als Verbindungen von Druck- mit Wärme- oder Kälteempfindungen, von Druck- oder Temperatur- mit Schmerzempfindungen vor. Diese Verschmelzungen sind durchweg unvollkommene, und zuweilen macht sich nicht einmal ein herrschendes Element entschieden gegenüber den andern Elementen geltend. Inniger sind die Verbindungen gewisser Geruchs- und Geschmacksempfindungen, die offenbar physiologisch durch die räumliche Nähe der Sinnesorgane, physikalisch durch die regelmäßige Verbindung bestimmter Reizeinwirkungen auf beide Sinne begünstigt werden. Dabei pflegen die stärkeren Empfindungen die herrschenden Elemente zu sein; und wo diese Rolle den Geschmacksempfindungen zufällt, da wird meist der zusammengesetzte Eindruck ganz als eine Geschmacksqualität aufgefaßt, daher die meisten im gewöhnlichen Leben so genannten "Geschmäcke" in Wirklichkeit Verbindungen von Geschmack und Geruch sind.
3. In der reichsten Mannigfaltigkeit bietet der Gehörssinn intensive Vorstellungen von allen möglichen Abstufungen der Zusammensetzung dar. Die relativ einfachsten unter ihnen, die den einfachen Tönen am nächsten stehen, sind die Einzelklänge. Verwickeltere Formen derselben bilden die Zusammenklänge, aus denen unter gewissen Bedingungen und unter gleichzeitiger Verbindung mit einfachen Geräuschempfindungen die zusammengesetzten Geräusche hervorgehen.
Der Einzelklang ist eine intensive Vorstellung, die aus einer Reihe regelmäßig in ihrer Qualität abgestufter Tonempfindungen besteht. Diese Elemente, die Teiltöne des Klanges, bilden eine vollkommene Verschmelzung, aus welcher die Empfindung des tiefsten Teiltons als das herrschende Element hervortritt. Nach ihm, dem Hauptton, wird der Klang selbst in bezug auf seine Tonhöhe bestimmt. Die übrigen Elemente werden als höhere Töne die Obertöne genannt. Sie werden alle zusammen als ein zweites zu dem herrschenden Element hinzutretendes Bestimmungsstück des Klanges, die Klangfarbe, aufgefaßt. Alle die Klangfarbe bestimmenden Teiltöne befinden sich auf der Tonlinie in bestimmten regelmäßigen Abständen vom Hauptton. Die vollständige Reihe der möglichen Obertöne eines Klanges wird nämlich gebildet durch die l. Oktave des Haupttons, deren Quinte, die 2. Oktave des Haupttons, deren große Terz und Quinte usw. Diese Reihe entspricht folgenden Verhältnissen der Schwingungszahlen der objektiven Tonwellen:
l (Hauptton), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 .... (Obertöne).
Bei konstant bleibender Höhe des Haupttons kann nun das zweite Bestimmungsstück der Klangqualität, die Klangfarbe, nach der Anzahl, Lage und relativen Stärke der Obertöne variieren. Auf diese Weise erklärt sich die ungeheure Mannigfaltigkeit der Klangfärbungen musikalischer Instrumente; ebenso, daß sich bei allen Instrumenten die Klangfarbe etwas mit der Tonhöhe ändert, indem bei tiefen Tönen die Obertöne relativ stark, bei hohen Tönen schwach zu sein pflegen und endlich, wenn sie jenseits der Grenze hörbarer Töne liegen, ganz verschwinden.
Psychologisch besteht hiernach die Hauptbedingung zur Entstehung eines Einzelklangs darin, daß eine Verschmelzung von Tonempfindungen mit nur einem herrschenden Element gegeben, und daß diese Verschmelzung eine vollkommene oder mindestens nahezu vollkommene ist. In der Regel unterscheidet man in dem Einzelklang die Obertöne nicht unmittelbar mit unbewaffnetem Ohr; man kann sie aber durch Hörrohre, die auf den gesuchten Oberton abgestimmt sind und daher diesen durch ihre Resonanz verstärken, wahrnehmbar machen. Physikalisch entspricht dieser zusammengesetzten psychologischen Beschaffenheit des Einzelklangs die komplexe Beschaffenheit der Schwingungen, die den Klang hervorbringen. Während nämlich der in der Empfindung einfache Ton durch einfache pendelartige Schwingungen entsteht (Fig. 9 A), wird jeder Klang, dem hinzutretende Obertöne eine bestimmte Klangfärbung verleihen, durch Schwingungen von verwickelterer Form hervorgebracht (B und C). Dabei läßt sich aber eine solche komplexe Schwingungsform stets in mehrere einfache, pendelartige Schwingungen zerlegen, unter denen die stärksten dem Grundton, die schwächeren einzelnen Gliedern der Obertonreihe des Klanges entsprechen. Hiernach ist die Klangvorstellung in ihrer Einheit wie in ihrer Zusammensetzung ein der objektiven Schwingungsform durchaus analoges subjektives Gebilde: der Einheit der Vorstellung entspricht die Einheit der physikalischen Klangform, der Unterscheidung der einzelnen Tonelemente in jener die geometrische Zerlegbarkeit der resultierenden Welle in mehrere einfache Schwingungen.
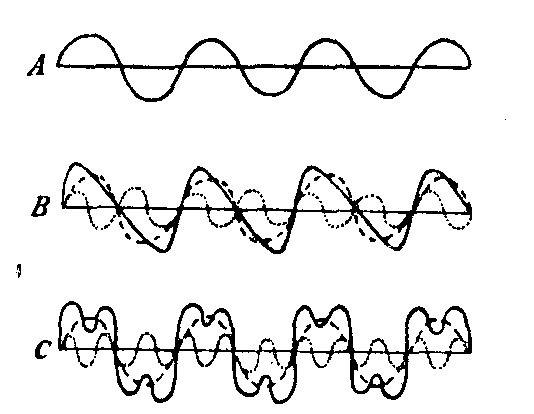
Fig. 9. Klangformen. A einfache pendelartige Schwingungen.
B u. C zusammengesetzte Klangformen (B
Grundton und erster, C Grundton u. zweiter Oberton).
4. Die Bedingungen, unter denen ein Element in einer Tonverbindung deren herrschendes ist, bestehen demnach: l) in der größeren Intensität desselben; 2) in seinem qualitativen Verhältnis zu den andern Teiltönen: der Hauptton muß der Grundton einer Tonreihe sein, deren Glieder zueinander harmonische Töne sind; 3) in der Koinzidenz der verschiedenen Teiltöne des Klanges, die objektiv durch die Einheit der Klangquelle gewährleistet ist (dadurch also, daß der Klang durch die Schwingungen nur einer Saite, einer Zungenpfeife usw. verursacht wird). Von diesen Bedingungen kann die erste hinwegfallen, ohne die Vorstellung des Einzelklangs wesentlich zu stören. Ist dagegen die zweite nicht erfüllt, so geht entweder, wenn der herrschende Grundton fehlt, die Verbindung in einen Zusammenklang, oder, wenn die Tonreihe keine harmonische ist, in ein Geräusch über; oder es bildet sich, falls sich beide Ursachen vereinigen, eine Zwischenform zwischen Klang und Geräusch. Fehlt die dritte Bedingung, so kann ebenfalls der Einzelklang in einen Zusammenklang übergehen. Eine Reihe unabhängig voneinander angegebener Stimmgabelklänge, die nach ihren intensiven und qualitativen Tonverhältnissen einen Einzelklang bilden müßten, erweckt z. B. in Wirklichkeit dennoch die Vorstellung eines Zusammenklangs.
5. Der Zusammenklang ist eine intensive Verbindung von Einzelklängen. Er ist daher eine unvollkommene Verschmelzung, in der mehrere herrschende Elemente enthalten sind. Dabei finden sich aber in der Regel in einem Zusammenklang alle möglichen Grade der Verschmelzung, namentlich wenn er aus Einzelklängen von zusammengesetzter Qualität besteht. Es bildet dann nämlich nicht nur jeder Einzelklang für sich ein vollständiges Verschmelzungsgebilde, sondern es verschmelzen auch wieder die durch ihre Haupttöne qualitativ bestimmten Bestandteile um so vollkommener, je mehr sie sich dem Verhältnis der Elemente eines Einzelklangs nähern. Darum pflegen bei einem Zusammenklang aus obertonreichen Klängen diejenigen Einzelklänge, deren Haupttöne den Obertönen eines ebenfalls in dem Zusammenklang enthaltenen Klanges entsprechen, mit diesem viel vollkommener als mit andern Klangbestandteilen, und die letzteren wieder um so mehr miteinander zu verschmelzen, je näher ihr Verhältnis dem der Anfangsglieder einer Obertonreihe kommt. So bilden in dem Vierklang c e g c' die Klänge c und c' eine nahezu vollkommene, die Klänge c und g, c und e aber unvollkommene Verschmelzungen; noch unvollkommener als bei diesen ist endlich die Verschmelzung der Klänge c und es. Ein Maß für den Grad der Verschmelzung erhält man in allen diesen Fällen, wenn man während einer gegebenen sehr kurzen Zeit einen Zusammenklang einwirken und den Beobachter entscheiden läßt, ob er bloß einen Klang oder mehrere Klänge wahrgenommen hat. Wird dieser Versuch öfter wiederholt, so ergibt die relative Anzahl der für die Einheit des Klanges abgegebenen Urteile ein Maß für den Grad der Verschmelzung.
6. Zu den in den Einzelklängen enthaltenen Elementen kommen in jedem Zusammenklang noch weitere hinzu, die aus der Superposition der Schwingungen innerhalb des Gehörapparats entstehen und zu neuen, für die verschiedenen Arten der Zusammenklänge charakteristischen Tonempfindungen Anlaß geben, die ebenfalls bald vollkommene, bald unvollkommene Verschmelzungen mit der ursprünglichen Klangmasse bilden können. Diese Empfindungen sind die der Differenztöne. Sie entsprechen, wie ihr Name andeutet, der Differenz der Schwingungszahlen zweier primärer Töne. Sie entstehen teils durch die Interferenz der Schwingungen außerhalb des Ohres, in dem umgebenden Luftraum (objektive Differenztöne), in welchem Fall sie durch an das Ohr angesetzte offene Röhren, die auf den Ton abgestimmt sind, sogenannte "Resonatoren", verstärkt werden; teils entstehen sie innerhalb des Gehörorgans, sei es durch die Interferenz der Schwingungen im äußeren Gehörapparat, namentlich, im Trommelfell und in den Gehörknöchelchen, sei es im innern Ohr, in welchen Fällen sie durch Resonatoren nicht verstärkt werden (subjektive Differenztöne). Durch die Differenztöne wird der Zusammenklang zu einem äußerst verwickelt aufgebauten psychischen Gebilde. Denn neben den Differenztönen der Haupttöne zweier Klänge können auch solche zwischen den Obertönen derselben, sowie zwischen den Differenztönen selbst oder zwischen ihnen und den primären Tönen entstehen. Man pflegt dann diese als Differenztöne 2., 3., 4. ... Ordnung zu bezeichnen. Von allen diesen Differenztönen sind die zwischen den Haupttönen und dann überhaupt diejenigen, die tiefer als die primären Töne des Zusammenklangs liegen, die stärksten1). Die Verschmelzung der Differenztöne mit den Haupttönen des Zusammenklangs ist wieder eine um so vollkommenere, je weniger intensiv sie sind, und je mehr sie sich mit den ursprünglichen Klangelementen als harmonische Töne in die einfache Tonreihe einfügen. Infolge dieser Eigenschaften haben die Differenztöne eine ähnlich charakteristische Bedeutung für die Zusammenklänge, wie die Obertöne für die Einzelklänge. Namentlich begründet der Umstand, daß bei bestimmten Intervallen (Oktave, Quinte, Quarte usw.) viele dieser Differenztöne teils verschwinden, teils miteinander zusammenfallen, wesentlich jene größere Einfachheit, die ein wichtiges Merkmal der Konsonanz des Zusammenklangs ausmacht.
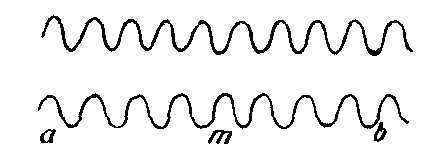
Fig. 10
Schwebungen zweier Töne.
Charakteristische Beispiele der verschiedenen Geräuschformen sind die menschlichen Sprachlaute, unter denen die Vokale Zwischenstufen zwischen Klang und Geräusch mit vorwaltendem Klangcharakter, die Resonanzlaute Dauergeräusche, die eigentlichen Konso-nanten dagegen kurz dauernde Geräusche sind. Bei der Flüsterstimme gehen auch die Vokale in Geräusche über. Der Umstand, daß hierbei durchaus ihre Unterschiede erhalten bleiben, beweist, daß die Charakteristik der Vokale im wesentlichen auf ihren Geräuschelementen beruht.
7a. Der Begriff der "Verschmelzung", der uns in einer etwas abweichenden Form auch noch in der Anwendung auf die extensiven räumlichen und zeitlichen Vorstellungen begegnen wird, bietet bei den intensiven Tonverschmelzungen die einfachsten Bedingungen dar, weil sich hier die aus der Verschmelzung hervorgehenden psychischen Verbindungen verhältnismäßig weniger von einer einfachen Addition ihrer Elemente unterscheiden, als dies bei den extensiven Verschmelzungen der Fäll ist. Der unterscheidenden Merkmale einer intensiven Tonverschmelzung gegenüber der Summe der Einzeltöne, aus denen sie besteht, gibt es nämlich im allgemeinen drei: 1) das Zurücktreten zahlreicher oder (z. B. bei manchen Geräuschen) aller Elemente gegenüber dem Gesamteindruck des Ganzen, 2) die Verbindung der Elemente zu einer Vorstellungseinheit mit einheitlichem Gefühlswert (wie sie besonders bei den harmonischen Zusammenklängen deutlich zu bemerken ist), und endlich 3) das Hervortreten bestimmter dominierender Elemente, wie z. B. beim einfachen Klang das des Grundtons. Von diesen drei Merkmalen sind die beiden ersten die konstanten, das dritte ist variabel. Es ist schon bei den Zusammenklängen weniger ausgeprägt als bei den Einzelklängen und kann bei den Geräuschen ganz verschwinden. Da übrigens alle diese Merkmale psychologische sind, so ist auch der Begriff der Verschmelzung selbst ein psychologischer, und es liegt um so weniger ein Anlaß vor, in den angegebenen drei Merkmalen etwas anderes zu sehen als den Ausdruck einer bestimmten psychologischen Gesetzmäßigkeit, da uns gleiche oder analoge Erscheinungen überall wieder begegnen, wo sich psychische Elemente verbinden. Von dieser einfachen empirischen Sachlage hat man sich gelegentlich bei der Anwendung des Begriffs der "Tonverschmelzung" namentlich dadurch entfernt, daß man die Verbindung der Elemente des Verschmelzungsprodukts als einen zu der Summe der Empfindungen hinzutretenden logischen Akt, als eine Art von Einheitsurteil betrachtete, und die Grundlagen dieses Einheitsurteils auf physiologischem Gebiet, nämlich in irgendeinem physischen Verschmelzungsvorgang in einem hypothetischen Organ des Gehirns suchte (Stumpf). Demgegenüber ist hervorzuheben, daß sich gerade die Tonverschmelzung unmittelbar als ein elementarer psychischer Verbindungsprozeß darbietet, der von einem Urteil gar nichts enthält, daß also dieses offenbar in jener Verwechslung einer logischen Reflexion über die psychischen Erlebnisse mit diesen selber seine Quelle hat, wie sie so vielfach noch heute aus der Vulgärpsychologie in die wissenschaftliche Psychologie herüberreicht (§ 2.). Vollends die Annahme eines nervösen "Verschmelzungsorgans" ist sichtlich eine bloße Verlegenheitshypothese.
Über eine der wesentlichsten der bei den Tonverschmelzungen hervortretenden Erscheinungen, über die Zusammensetzung einer jeden Klangvorstellung aus der Summe der elementaren Tonempfindungen, in die sich der Klang auch objektiv zerlegen läßt, hat nun zum erstenmal die schon oben (§ 6) erwähnte, von Helmholtz aufgestellte "Resonanzhypothese" Rechenschaft zu geben gesucht. Indem man bei ihr annimmt, bestimmte Teile des Gehörapparats seien derart abgestimmt, daß durch Tonwellen von einer gewissen Schwingungszahl immer nur die entsprechend abgestimmten Teile in Mitschwingungen versetzt werden, wird nämlich im allgemeinen die analysierende Fähigkeit des Gehörssinns begreiflich gemacht. Gewisse Schwierigkeiten erwachsen dieser Hypothese nur aus der Existenz der subjektiven Differenztöne. Diese können nur entstehen, indem die primären Tonschwingungen in irgendwelchen schwingungsfähigen Gebilden des Ohres resultierende Schwingungen erzeugen. Die Annahme von Helmholtz, daß die Teile des Mittelohrs (Trommelfell und Gehörknöchelchen) diese Gebilde seien, läßt sich aber nicht mehr aufrechterhalten, da nach den Beobachtungen der Ohrenärzte Differenztöne noch von Patienten empfunden werden, bei denen jene Teile des Mittelohrs verloren gegangen sind (Dennert), und da zuweilen die Differenztöne die primären Töne an Intensität übertreffen können (Hermann). Diese Schwierigkeiten dürften sich aber beseitigen lassen, wenn man die Resonanzhypothese in dem Sinn ergänzt, daß man die Angriffspunkte für die Erregung von Differenztönen (und möglicherweise auch von Schwebungen) nicht vor dem Resonanzapparat (im Mittelohr), sondern hinter ihm (im Labyrinth) voraussetzt, indem man annimmt, daß die Spindel der Schnecke teils direkt, teils von der Basilarmembran aus in Schwingungen geraten und diese auf die in ihren feinen Kanälen verlaufenden Akustikusfasern übertragen könne. Freilich ist diese Hilfshypothese nur durchführbar, wenn man die Annahme einer streng gesonderten spezifischen Energie der einzelnen Akustikusfasern und einer ausschließlichen Erregbarkeit derselben von der Grundmembran aus aufgibt. Mittels anderer Hörtheorien, die auf die Resonanzhypothese ganz verzichten, hat man jedoch das Phänomen der Klanganalyse bis jetzt nicht abzuleiten vermocht. Ist eine Beseitigung der Resonanzhypothese nicht möglich, so dürfte daher einer Ergänzung derselben in dem angedeuteten Sinne kaum etwas im Wege stehen. – Über die Eigenschaften der bei den Zusammenklängen entstehenden zusammengesetzten Gefühle (der Harmonie und Disharmonie) vgl. unten § 12, 9.
Literatur. Helmholtz, Lehre von den Tonempfindungen, l. u. 2. Abt. Stumpf, Tonpsychologie, Bd. 2. K. L. Schaefer, Gehörssinn in Nagels Handbuch der Physiol., Bd. 3, 2. Révész, Zur Grundlegung der Tonpsyohologie, 1912. von Oettingen, Das duale Harmoniesystem, 1914. Phys. Psych.6, II, Kap. 10 u. 12. M. u. T.5 5. Vorl. – Tonverschmelzung: Lipps, Grundtatsachen des Seelenlebens, Kap. 21. Zeitschr. f. Psych., Bd. 19. Stumpf, ebenda, Bd. 15, § 8 u. § 9. Beiträge zur Akustik u. Musikwissenschaft, Heft 1–3. B. Schulze, Phil. Stud., Bd. 14. H. de Grant, Ztschr. f. Psych., II. Abt., Bd. 44. Differenztöne, Schwebungen usw.: R. Koenig, Poggendorffs Ann.derPhysik, Bd.l57 u. 158. Hermann, Pflügers Archiv f. Physiol., Bd. 49. Schaefer, ebenda, Bd. 78 u. 83. Krueger, Phil. Stud., Bd. 16 u. 17. Archiv f. Psychol., Bd. l u. 2. Psychol. Stud., Bd. l, 2 u. 4. Dennert, Arch. f. Ohrenheilkunde, Bd. 24. Hensen, Ber. der Berliner Akad. 1902. Versuche neuer Hörtheorien: Hermann, Pflügers Archiv, Bd. 56. Ewald, ebenda, Bd. 76.