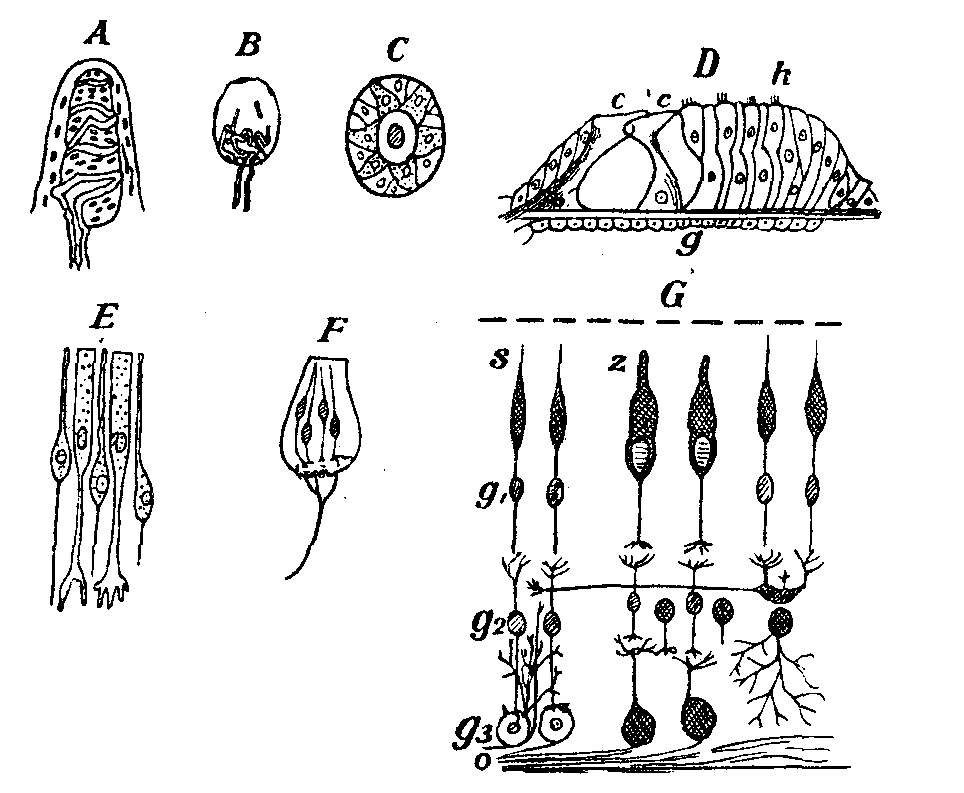
1. Der Begriff der "reinen Empfindung" setzt nach § 5 eine doppelte Abstraktion voraus: l) die Abstraktion von den Vorstellungen, in denen die Empfindung vorkommt, und 2) die Abstraktion von den einfachen Gefühlen, mit denen sie verbunden ist. Die in diesem Sinne definierten reinen Empfindungen bilden eine Reihe disparater Qualitätssysteme; und jedes dieser Systeme, wie das der Druckempfindungen, der Ton-, der Lichtempfindungen, ist entweder ein gleichförmiges oder ein mannigfaltiges Kontinuum (§ 5, 5), das, in sich abgeschlossen, keinerlei Übergänge zu einem der andern Systeme erkennen läßt.
2. Die Entstehung der Empfindungen ist, wie uns die physiologische Erfahrung lehrt, regelmäßig an gewisse physische Vorgänge gebunden, die teils in der unsern Körper umgebenden Außenwelt, teils in bestimmten Körperorganen ihren Ursprung haben, und die wir mit einem der Physiologie entlehnten Ausdruck als die Sinnesreize oder Empfindungsreize bezeichnen. Besteht der Reiz in einem Vorgang der Außenwelt, so nennen wir ihn einen physikalischen; besteht er in einem Vorgang in unserm eignen Körper, so nennen wir ihn einen physiologischen. Die physiologischen Reize lassen sich dann wieder in periphere und zentrale unterscheiden, je nachdem sie in Vorgängen in den verschiedenen Körperorganen außerhalb des Gehirns oder in solchen im Gehirn selbst bestehen. In zahlreichen Fällen ist eine Empfindung von diesen dreierlei Reizungsvorgängen begleitet: so wirkt z.B. ein äußerer Lichteindruck als physikalischer Reiz auf das Auge; in diesem und in dem Sehnerven entsteht dann eine periphere physiologische Reizung, endlich in den in gewissen Teilen des Mittelhirns (Vierhügeln, Kniehöcker) und in der hinteren Region der Großhirnrinde (Okzipitalhirn) gelegenen Optikusendigungen eine zentrale physiologische Reizung. In vielen Fällen kann aber der physikalische Reiz fehlen, während der physiologische in seinen beiden Formen vorhanden ist: so z.B., wenn wir infolge einer heftigen Bewegung des Auges einen Lichtblitz wahrnehmen; und in andern Fällen kann sogar der zentrale Reiz allein vorhanden sein: so z. B., wenn wir uns an irgendeinen früher gehabten Lichteindruck erinnern. Demnach ist der zentrale Reiz der einzige, der konstant die Empfindung begleitet; der periphere muß sich aber mit dem zentralen, und der physikalische muß sich sowohl mit dem peripheren wie mit dem zentralen verbinden, wenn Empfindung entstehen soll.
3. Die physiologische Entwicklungsgeschichte macht es wahrscheinlich, daß die Scheidung der verschiedenen Empfindungssysteme sich zum Teil erst im Laufe der generellen Entwicklung ausgebildet hat. Das ursprünglichste Sinnesorgan ist nämlich die äußere Körperbedeckung mit den ihr zugeordneten empfindungsfähigen inneren Organen. Die Organe des Geschmacks, des Geruchs, des Gehörs, des Gesichts dagegen entstehen erst später als Differenzierungen der Körperbedeckung. Man darf daher vermuten, daß auch die jenen speziellen Sinnesorganen entsprechenden Empfindungssysteme aus den Systemen des allgemeinen Sinnes, den Druck-, Wärme- und Kälteempfindungen, durch allmähliche Differenzierung entstanden sind; und es ist denkbar, daß bei den niederen Tieren einzelne der jetzt streng geschiedenen Qualitätssysteme einander noch näher stehen. Physiologisch spricht sich die ursprünglichere Natur des allgemeinen Sinnes überdies darin aus, daß bei ihm entweder gar keine oder nur sehr einfache Einrichtungen zur Übertragung der Sinnesreize auf die Sinnesnerven vorhanden sind. Denn die Druck-, Temperatur- und Schmerzreize können von Hautstellen aus, an denen trotz sorgfältiger Nachforschungen bis jetzt keine besonderen Endapparate nachgewiesen werden konnten, Empfindungen auslösen. An den für Druckempfindungen empfindlichsten Stellen gibt es allerdings besondere Aufnahmeapparate (Tastkörper, Fig. 2 A, Endkolben B, Vatersche Körper); aber die Beschaffenheit dieser Apparate macht es wahrscheinlich, daß sie nur die mechanische Übertragung der Druckreize auf die Nervenendigungen begünstigen. Spezielle Aufnahmeapparate für Wärme-, Kälte- und Schmerzreize sind endlich überhaupt noch nicht aufgefunden worden.
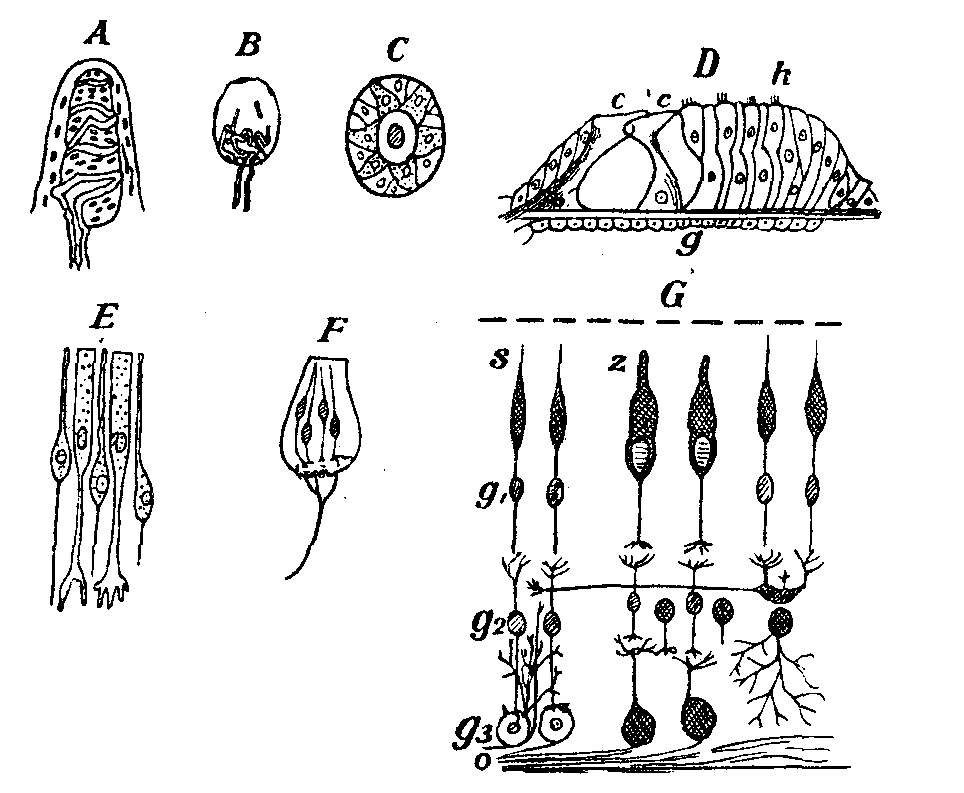
Fig. 2. Sinnesnervenendigungen. A Tastkörper.
B
Endkolben. C Gehörbläschen. D Schema des Cortischen
Organs der Schnecke: cc Cortische Bogen, h Haarzellen,
g
Grundmembran mit Nervenfasern. E Riechnervenendigung. F Schmeckbecher
aus der Zunge. G Retinaschichten: s, z Stäbchen und
Zapfen (innere Schicht der Retina), g1,
g2 kleinere,
g3
große Nervenzellen, o Optikusfasern (äußere Schicht
der Retina).
Dagegen treffen wir in den höher entwickelten speziellen Sinnesorganen überall umfangreiche Einrichtungen, welche nicht bloß eine Übertragung der Reize auf die Sinnesnerven, sondern im allgemeinen auch physiologische Transformationen der Reizungsvorgänge vermitteln, die für die Entstehung der eigentümlichen Qualitäten der Empfindungen unerläßlich zu sein scheinen. Doch bieten die einzelnen Sinne in dieser Beziehung wieder ein verschiedenes Verhalten dar.
Namentlich scheinen in dem Gehörorgan die Aufnahmeapparate nicht die nämliche Bedeutung zu besitzen, wie in dem Geruchs-, Geschmacks- und Gesichtsorgan. Auf ihrer niedersten Entwicklungsstufe fallen nämlich die Gehörorgane morphologisch wie funktionell mit statischen oder tonischen Sinnesapparaten zusammen, welche, die Lage- und Bewegungsempfindungen des Körpers vermittelnd, vielleicht als innere Dependenzen des allgemeinen Tastsinns betrachtet werden können, während sie möglicherweise zugleich, als primitive Gehörorgane, durch Schallwellen erregbar sind. Ein primitives Organ dieser Art besteht im allgemeinen aus einem Bläschen, das mit einem oder mit einigen kleinen Steinchen (Otolithen) gefüllt ist, und in dessen Wänden ein Nervenbündel sich ausbreitet (C.) Werden die Gehörsteinchen durch die Eigenbewegungen des Körpers oder durch starke Schalleindrücke in Oszillationen versetzt, so wirken diese, wie wir annehmen dürfen, als eine rasche Folge schwacher Druckreize auf die Fasern des Nervenbüschels ein. Bei den Wirbeltieren scheidet sich dann der tonische Apparat von dem Gehörorgan. Gleichwohl bleiben beide auch bei ihnen noch räumlich nahe verbunden, indem das sogenannte Bogenlabyrinth die Funktionen eines tonischen Organs, die Schnecke die des Gehörorgans übernimmt. Doch so verwickelt auch das Gehörorgan bei den höheren Tieren und beim Menschen gebaut ist, so erinnert es in seinen wesentlichen Einrichtungen immer noch an jenen einfachsten Typus. In der Schnecke durchsetzen die Hörnerven die von zahlreichen feinen Kanälen durchbohrte Spindel und treten dann durch die nach dem Hohlraum der Schnecke gekehrten Poren, um sich in einer diesen Hohlraum in spiraligen Windungen durchziehenden, straff gespannten und durch besondere starre Pfeiler (die Cortischen Bogen) beschwerten Membran auszubreiten (D). Da diese Membran, die Grundmembran genannt, nach akustischen Gesetzen in Mitschwingungen geraten muß, sobald Schallschwingungen das Ohr treffen, so spielt dieselbe, wie es scheint, hier die nämliche Rolle, wie sie den Hörsteinchen bei der niedersten, noch undifferenzierten Form eines Gehörorgans zukommt. Aber dabei ist noch eine andere Veränderung eingetreten, die die große Mannigfaltigkeit der Tonempfindungen begreiflich macht. Die Grundmembran der Schnecke hat nämlich in ihren verschiedenen Teilen einen wechselnden Querdurchmesser, indem sie von der Basis zur Spitze des Schneckenkanals immer breiter wird. Sie verhält sich also wie ein System gespannter Saiten von verschiedener Länge. Wie bei einem solchen unter sonst gleichen Bedingungen die längeren Saiten auf tiefere, die kürzeren auf höhere Töne abgestimmt sind, so läßt sich daher das gleiche auch für die Teile der Grundmembran annehmen. Während wir hiernach vermuten dürfen, daß das den einfachsten mit Otolithen versehenen Gehörorganen entsprechende Empfindungssystem ein gleichförmiges und zum Teil sogar noch von den Druckempfindungen nicht deutlich geschiedenes sei, macht die Differenzierung dieses Apparats in der Schnecke der höheren Tiere die Entwicklung jenes ursprünglich gleichförmigen zu einem überaus mannigfaltigen Empfindungssystem begreiflich. Gleichwohl bleibt die Beschaffenheit des Aufnahmeapparates insofern eine ähnliche, als derselbe zwar hier wie dort zu einer möglichst vollkommenen Übertragung des physikalischen Reizes auf die Sinnesnerven, nicht aber zu einer Transformation dieses Reizes geeignet erscheint.
Von diesem Verhalten unterscheiden sich nun wesentlich der Geruchs-, der Geschmacks- und der Gesichtssinn. Bei ihnen finden sich physiologische Einrichtungen, die eine direkte Einwirkung der Reize auf die Sinnesnerven unmöglich machen, indem zwischen beide eigentümliche Apparate eingeschaltet sind, in denen der äußere Sinnesreiz Veränderungen hervorbringt, die dann erst als die eigentlichen, die Sinnesnerven erregenden Reize wirken. Diese Apparate sind in den drei genannten Organen eigentümlich metamorphosierte Oberhautzellen, sogenannte Sinneszellen, deren eines Ende dem Reize zugekehrt ist, während das andere in einen Nervenfaden übergeht. In der Riechmembran der Nase finden sich diese durch ihre schmalen, fibrillenartigen Enden ausgezeichneten Zellen zwischen indifferenten, breiteren Zellen zerstreut (E). In der Zunge bilden sie, dicht beisammenstehend, knospenartige Gebilde, sogenannte Schmeckbecher (F). Im Auge endlich bilden sie, aus dickeren, hauptsächlich in der Mitte gelagerten Elementen, den Zapfen, und schmäleren, die äußeren Teile einnehmenden, den Stäbchen, bestehend, mit ihren Fortsetzungen in die Nervenfasern eine eigene Membran, die Netzhaut oder Retina (G). Alles spricht dafür, daß hier die Aufnahmeapparate nicht bloße Übertragungs-, sondern Transformationsapparate der Reize sind. Dabei ist wahrscheinlich in diesen drei Fällen die Transformation eine chemische, indem bei dem Geruchs- und Geschmackssinn äußere chemische Einwirkungen, bei dem Gesichtssinn Lichteinwirkungen in den Sinneszellen chemische Zersetzungen hervorrufen, die dann als die eigentlichen Sinnesreize wirken.
Hiernach lassen sich diese drei als die chemischen Sinne dem Druck- und dem Gehörssinn als den mechanischen Sinnen gegenüberstellen. In welche dieser Klassen die Kälte- und die Wärmeempfindungen zu stellen seien, läßt sich noch nicht mit Sicherheit bestimmen. Ein Symptom der direkteren Beziehung zwischen Reiz und Empfindung bei den mechanischen, gegenüber der indirekten bei den chemischen Sinnen besteht übrigens darin, daß bei den ersteren die Empfindung nur eine sehr kurze Zeit den äußeren Reiz zu überdauern pflegt, während bei den letzteren diese Nachdauer eine viel längere ist. So kann man z. B. bei einer raschen Folge von Druck- und namentlich von Schallreizen die einzelnen noch deutlich voneinander unterscheiden; Licht-, Geschmacks- und Geruchseindrücke dagegen fließen schon bei mäßiger Geschwindigkeit ihrer Aufeinanderfolge zusammen. Die Temperaturreize der Haut scheinen in dieser Beziehung den chemischen Reizen zu gleichen, daher man auch bei ihnen vielleicht an eine indirekte Reizwirkung denken darf.
4. Da die Reize regelmäßige physische Begleiterscheinungen der psychischen Elementarprozesse, der Empfindungen, sind, so wurde der Versuch nahegelegt, bestimmte Beziehungen zwischen diesen beiderlei Vorgängen festzustellen. Die Physiologie pflegte hierbei die Empfindungen als die Wirkungen der physiologischen Reize aufzufassen, nahm aber zugleich an, daß in diesem Fall eine eigentliche Erklärung der Wirkung aus ihrer Ursache unmöglich sei, sondern daß man sich darauf beschränken müsse, die Konstanz der Beziehungen zwischen bestimmten Reizursachen und bestimmten Empfindungswirkungen festzustellen. Nun findet sich, daß in vielen Fällen verschiedene Reize, sobald sie nur auf dieselben physiologischen Aufnahmeapparate einwirken, qualitativ gleiche Empfindungen auslösen: so beobachtet man z.B. auch bei mechanischer oder elektrischer Reizung des Auges Lichtempfindungen. Indem man dieses Resultat verallgemeinerte, gelangte man zu dem Satze, jedes einzelne Aufnahmeelement eines Sinnesorgans und jede einzelne sensible Nervenfaser samt ihrer zentralen Endigung sei nur einer einzigen Empfindung von fest bestimmter Qualität fähig, und die Mannigfaltigkeit der Empfindungsqualitäten sei daher lediglich durch die Mannigfaltigkeit jener physiologischen Elemente von spezifisch verschiedener Energie verursacht. Dieser Satz, den man als das "Gesetz der spezifischen Energie" zu bezeichnen pflegt, ist aber, abgesehen davon, daß er die Ursachen der mannigfaltigen Empfindungsunterschiede bloß auf eine qualitas occulta der physiologischen Sinnes- und Nervenelemente zurückführt, aus drei Gründen unhaltbar.
1) Er steht im Widerspruch mit der physiologischen Entwicklungsgeschichte der Sinne. Wenn, wie wir nach dieser annehmen müssen, die mannigfaltigen Empfindungssysteme aus ursprünglich einfacheren und gleichförmigeren hervorgegangen sind, so müssen auch die physiologischen Sinneselemente veränderlich sein; das ist aber nur möglich, wenn sie durch die Reize, die auf sie einwirken, modifiziert werden können. Darin liegt eingeschlossen, daß die Sinneselemente überhaupt erst in sekundärer Weise, nämlich infolge der Eigenschaften, die sie durch die ihnen zugeführten Reizungsvorgänge annehmen, die Empfindungsqualität bestimmen. Erfahren nun die Sinneselemente im Laufe längerer Zeit tiefgreifende Veränderungen, die von der Beschaffenheit der sie treffenden Reize abhängen, so ist das wiederum nur möglich, wenn überhaupt der physiologische Reizungsvorgang in den Sinneselementen in irgendeinem Grade mit der Qualität des Reizes variiert.
2) Der Begriff der spezifischen Energie widerspricht der Tatsache, daß in zahlreichen Sinnesgebieten der Mannigfaltigkeit der Empfindungsqualitäten eine analoge Mannigfaltigkeit der physiologischen Sinneselemente durchaus nicht korrespondiert. So können von einem einzigen Punkte der Netzhaut aus alle möglichen Licht- und Farbenempfindungen erregt werden. So finden wir ferner im Geruchs- und Geschmacksorgan gar keine deutlich verschiedenen Formen von Sinneselementen; trotzdem können selbst beschränkte Teile dieser Sinnesflächen eine Mannigfaltigkeit von Empfindungen vermitteln, die namentlich beim Geruchssinn ausnehmend groß ist. In solchen Fällen, wo man allen Grund hat, anzunehmen, daß wirklich qualitativ verschiedene Empfindungen in verschiedenen Sinneselementen entstehen, wie beim Gehörssinn, weisen aber die Einrichtungen des Sinnesapparats darauf hin, daß diese Verschiedenheit nicht durch irgendeine Eigenschaft der Nervenfasern oder sonstiger Sinneselemente zustande kommt, sondern daß sie in der besonderen Lagerungsweise dieser ihren ursprünglichen Grund hat. Sind in der Schnecke des Gehörorgans die einzelnen Teile der Grundmembran auf verschiedene Töne abgestimmt, so werden natürlich auch verschiedene Hörnervenfasern durch verschiedene Tonwellen gereizt. Aber dies ist nicht durch eine ursprüngliche, rätselhafte Eigenschaft der einzelnen Hörnervenfasern, sondern nur durch die Art ihrer Verbindung mit den Aufnahmeapparaten bedingt.
3) Die Sinnesnerven und die zentralen Sinneselemente können deshalb keine ursprüngliche spezifische Energie besitzen, weil durch ihre Reizung nur dann die entsprechenden Empfindungen entstehen, wenn mindestens zuvor während einer zureichend langen Zeit die peripheren Sinnesorgane den adäquaten Sinnesreizen zugänglich gewesen sind. Den Blind- und den Taubgeborenen fehlen, soviel man weiß, auch wenn die Sinnesnerven und Sinneszentren ursprünglich ausgebildet waren, die Licht- und die Tonqualitäten vollständig.
Alles spricht demnach dafür, daß die Verschiedenheit der Empfindungsqualität durch die Verschiedenheit der in den Sinnesorganen entstehenden Reizungsvorgänge bedingt ist, und daß die letzteren in erster Linie von der Beschaffenheit der physikalischen Sinnesreize und erst in zweiter von der durch die Anpassung an diese Reize entstehenden Eigentümlichkeit der Aufnahmeapparate abhängen. Infolge dieser Anpassung kann es dann aber auch geschehen, daß selbst dann, wenn statt des adäquaten, die ursprüngliche Anpassung der Sinneselemente bewirkenden physikalischen Reizes ein andrer Reiz einwirkt, die dem adäquaten Reiz entsprechende Empfindung entsteht. Doch gilt dies weder für alle Sinnesreize, noch für alle Sinneselemente. So kann man z. B. mit Wärme- oder Kältereizen weder Druckempfindungen in der Haut noch irgendeine andere Empfindungsqualität in den speziellen Sinnesorganen auslösen; mechanische und elektrische Reize rufen nur, wenn sie die Netzhaut, nicht wenn sie den Sehnerven treffen, Lichtempfindungen hervor; ebenso lassen sich durch mechanische und elektrische Reize keine Geruchs und Geschmacksempfindungen bewirken, es sei denn, daß der elektrische Strom eine chemische Zersetzung erzeugt, bei der adäquate chemische Reize entstehen.
5. Der Natur der Sache nach ist es unmöglich, aus der Beschaffenheit der physikalischen und physiologischen Reizungsvorgänge die Beschaffenheit der Empfindungen abzuleiten, da die Reizungsvorgänge der naturwissenschaftlichen oder mittelbaren, die Empfindungen dagegen der psychologischen oder unmittelbaren Erfahrung angehören, beide also unvergleichbar miteinander sind. Wohl aber besteht insofern ein Wechselverhältnis zwischen den Empfindungen und den physiologischen Reizungsvorgängen, als verschiedenen Empfindungen stets verschiedene Reizungsvorgänge entsprechen. Dieser Satz von dem Parallelismus der Empfindungsunterschiede und der physiologischen Reizungsunterschiede ist ein wichtiges Hilfsprinzip sowohl der psychologischen wie der physiologischen Empfindungslehre. In der ersteren wendet man ihn an, um mittels willkürlicher Variation der Reize bestimmte Veränderungen der Empfindung hervorzubringen; in der letzteren bedient man sich desselben, um aus der Gleichheit oder Verschiedenheit der Empfindungen auf die Gleichheit oder Verschiedenheit der physiologischen Reizungsvorgänge zurückzuschließen. Das nämliche Prinzip bildet überdies die Grundlage sowohl unserer praktischen Lebenserfahrung wie unserer theoretischen Erkenntnis der Außenwelt.
5a. Das Prinzip der "spezifischen Energie" liegt zwar schon vielen älteren physiologischen Arbeiten stillschweigend zugrunde, ist aber zuerst von Johannes Müller präzis formuliert worden. Später hat es namentlich Helmholtz für die Theorie der Ton- und Lichtempfindungen verwertet. Dabei wurde die ursprüngliche Fassung insofern etwas abgeändert, als man sich in der Regel nicht mehr an die Nervenfasern, sondern an die peripheren Sinneselemente (Stäbchen und Zapfen der Netzhaut, Akustikusendigungen in der Schnecke usw.), zuweilen auch an die Nervenzellen der Sinneszentren oder an beide zugleich die spezifische Energie gebunden dachte, während die Nerven selbst meist als indifferente Leiter galten. Die so entwickelten Vorstellungen sind jedoch durchaus hypothetisch. Unsere Kenntnis der Prozesse in den Sinneselementen und Nervenzellen, ja zum Teil sogar die anatomische Kenntnis dieser Elemente ist noch viel zu unvollkommen, um darauf Schlüsse gründen zu können. Es bleiben also nur die Erscheinungen der Erregung gleicher Empfindungen durch verschiedenartige Reize, die aber, wie oben bemerkt, dem Prinzip keineswegs eine allgemeine Geltung sichern, während sie innerhalb der Grenzen, in denen sie zutreffen, viel angemessener aus dem allgemeinen Prinzip der Anpassung der Sinneselemente an die Reize abgeleitet werden können.
Literatur. J. Müller, Lehrbuch der Physilogie des Menschen, 4. Aufl., I, 1844, 667. Helmholtz, Physiologische Optik, 2. Aufl., 233. Lehre von den Tonempfindungen, Abschn. III und IV. Goldscheider, Ges. Abhandlungen I, 1898, l. Weinmann, Die Lehre von den spezifischen Sinnesenergien, 1895. W. Nagel, Allg. Einleitung zur Physiologie der Sinne in: Handbuch der Physiol. des Menschen, III, 1905. Phys. Ps.6, I, Kap. 8, 4.
A. Die Empfindungen des allgemeinen Sinnes.
6. Der Begriff des "allgemeinen Sinnes" hat eine zeitliche und eine räumliche Bedeutung. Der Zeit nach ist der allgemeine Sinn derjenige, der allen andern vorangeht und deshalb allein allen beseelten Wesen zukommt. Räumlich hat er die ausgebreitetste den Reizen zugängliche Sinnesfläche. Er umfaßt nicht bloß die ganze äußere Haut mit den an sie angrenzenden Schleimhautteilen der Körperhöhlen, sondern auch eine große Zahl innerer Organe, wie die Gelenke, Muskeln, Sehnen, Knochen usw., in denen sich sensible Nerven ausbreiten, und die entweder fortwährend oder, wie z. B. die Knochen, zeitweise und unter besonderen Bedingungen Reizen zugänglich sind.
Der allgemeine Sinn umfaßt vier spezifisch voneinander verschiedene Empfindungssysteme: Druck-, Kälte-, Wärme- und Schmerzempfindungen. Nicht selten erregt ein einzelner Reiz mehrere dieser Empfindungen. Dann wird aber die Empfindung ohne weiteres als eine gemischte erkannt, deren einzelne Komponenten verschiedenen Systemen, z. B. dem der Druck- und der Wärmeempfindungen, der Druck- und der Schmerz-, der Wärme- und der Schmerzempfindungen usw., angehören. Ebenso entstehen infolge der räumlichen Ausbreitung des Sinnesorgans sehr häufig Mischungen verschiedener Qualitäten eines und desselben Systems, z. B. bei der Berührung einer ausgedehnten Hautstelle qualitativ verschiedene Druckempfindungen.
Die vier Empfindungssysteme des allgemeinen Sinnes sind sämtlich gleichförmige Systeme (§ 5, 5); auch dadurch gibt sich dieser Sinn gegenüber den andern, deren Systeme sämtlich mannigfaltige sind, als der genetisch tiefer stehende zu erkennen. Die durch die äußere Haut vermittelten sowie die durch die Spannungen und Bewegungen der Muskeln, der Gelenke und Sehnen entstehenden Druckempfindungen samt den Wärme-, Kälte- und Schmerzempfindungen der Haut faßt man unter dem Namen Tastempfindungen zusammen und stellt ihnen die sämtlichen Empfindungen in inneren Organen (Magen, Darm, Lungen usw.) als Gemeinempfindungen gegenüber. Die Tastempfindungen lassen sich dann wieder in die äußeren und die inneren unterscheiden, wobei man unter den ersteren die Empfindungen der äußeren Haut, unter den letzteren die bei den Tastbewegungen in den Gelenken, Muskeln und Sehnen entstehenden Druckempfindungen versteht. Diese werden wohl auch nach ihrem physiologischen Sitz als Gelenkempfindungen und Muskelempfindungen, nach ihren Entstehungsbedingungen als Bewegungs- oder Kontraktionsempfindungen und als Spannungs- oder Kraftempfindungen unterschieden.
7. Die Fähigkeit der verschiedenen Teile des allgemeinen Sinnesorganes, Reize aufzunehmen und Empfindungen auszulösen, läßt sich nun mit zureichender Genauigkeit nur an der äußeren Haut prüfen. Rücksichtlich der inneren Teile kann man bloß feststellen, daß die Gelenke in sehr hohem, die Muskeln und Sehnen in geringerem Maße für Druckreize empfindlich sind, während Wärme-, Kälte- und Schmerzempfindungen überhaupt nur ausnahmsweise, und in auffallenderem Grade nur unter abnormen Bedingungen in inneren Organen entstehen. Auf der äußeren Haut dagegen und den unmittelbar an sie grenzenden Schleimhautbedeckungen gibt es keinen Punkt, der nicht gleichzeitig für Druck-, Wärme-, Kälte- und Schmerzreize empfindlich wäre. Doch variiert der Grad der Empfindlichkeit an den verschiedenen Hautstellen, und zwar so, daß die Punkte größter Druck-, Wärme- und Kälteempfindlichkeit im allgemeinen nicht zusammenfallen. Nur die Schmerzempfindlichkeit verhält sich überall ziemlich gleichförmig, höchstens darin abweichend, daß der Schmerzreiz an einzelnen Punkten schon oberflächlich wirkt, während er an andern tiefer eindringen muß. Dagegen zeigen sich für die Druck-, die Wärme- und die Kältereize einzelne annähernd punktförmige Hautstellen, die man deshalb als Druck-, Wärme- und Kältepunkte bezeichnet hat, besonders bevorzugt. Sie sind über die verschiedenen Hautgebiete in sehr verschiedener Menge zerstreut. Punkte verschiedener Qualität fallen zwar nicht zusammen; doch können die Temperaturpunkte immer zugleich Druck- und Schmerzempfindungen vermitteln, und an den Kältepunkten bewirken mäßige Wärmereize in der Regel ebenfalls Wärmeempfindungen, während intensivere Hitzegrade wieder Kälteempfindungen (sogenannte "paradoxe" Empfindungen) hervorrufen, und die Wärmepunkte auf Kälte nicht selten mit "kühl" (sog. "konträre" Empfindung) niemals aber mit "warm" reagieren. Endlich entstehen sowohl an den Wärme- wie an den Kältepunkten auch auf lokal beschränkte mechanische und elektrische Reize in der Regel die adäquaten Empfindungen.
8. Von den genannten vier Qualitäten bilden die Druck- und die Schmerzempfindungen in sich abgeschlossene Systeme, die weder zueinander noch zu den beiden Systemen der Temperaturempfindung Beziehungen darbieten. Dagegen pflegen wir die letzteren in das Verhältnis eines Gegensatzes zu bringen, indem wir Wärme und Kälte nicht bloß als verschiedene, sondern als kontrastierende Empfindungen auffassen. Wahrscheinlich hat diese Auffassung ihre Quelle teils in den Bedingungen der Entstehung dieser Empfindungen, teils in den sie begleitenden Gefühlen. Während sich nämlich die übrigen Qualitäten beliebig miteinander verbinden und Mischempfindungen bilden können, z. B. Druck und Wärme, Druck und Schmerz, Kälte und Schmerz usw., pflegen Wärme und Kälte vermöge der Bedingungen ihrer Erzeugung einander auszuschließen, so daß also an einer gegebenen Hautstelle nur entweder Wärme- oder Kälteempfindung oder keine von beiden entsteht. Außerdem sind aber an Wärme und Kälte elementare Gefühlsgegensätze geknüpft, zwischen denen der Punkt, wo beide Empfindungen verschwinden, als der Indifferenzpunkt erscheint.
Noch in einer andern Beziehung verhalten sich endlich die beiden Systeme der Temperaturempfindungen eigenartig. Sie sind nämlich in hohem Grade von den wechselnden Bedingungen der Reizeinwirkung auf das Sinnesorgan abhängig, indem eine erhebliche Erhöhung über seine Eigentemperatur als Wärme, eine Vertiefung unter dieselbe als Kälte empfunden wird. Zugleich paßt sich die Eigentemperatur selbst, die dieser Indifferenzzone zwischen beiden Empfindungsarten entspricht, in ziemlich weiten Grenzen verhältnismäßig rasch der gerade bestehenden Außentemperatur an. Da sich auch in dieser Hinsicht die beiden Empfindungen gleichartig verhalten, so begünstigt dies weiterhin die Auffassung ihrer Zusammengehörigkeit und ihres Gegensatzes.
Literatur.
E. H. Weber, Tastsinn und Gemeingefühl. Handwörterb. d. Physiol.
III, 2. Blix, Zeitschr. f. Biologie 20, 21. Goldscheider, Archiv f. Physiol.,
1885, 1886 u. 1887 u. Ges. Abhandlungen 1898, I (Druck-, Wärme-, Kältepunkte),
Ges. Abhandl. II (Muskelsinn). Kiesow, Phil. Stud. Bd. 9–14. von Frey,
Ber. der sächs. Ges. d. Wiss., Bd. 46 u. 47 und Abhandl. der math.-phys.
Kl., Bd. 23. von Frey u. Kiesow, Zeitschr. f. Psychol., Bd. 20. Alrutz,
Skandin. Archiv f. Physiol., Bd. 7 u. 10. Thunberg, ebenda, Bd. 11 und
Nagels Handb. der Physiol., III, 8. 647ff. Phys. Psych.6,
II, Kap. 18. M. u. T.5
Vorl. 5.
B. Die Schallempfindungen.
9. Wir besitzen zwei voneinander unabhängige, aber infolge der Mischung der Eindrücke in der Regel verbundene Systeme von Schallempfindungen: das der Geräusch- und das der Tonempfindungen.
Einfache Geräuschempfindungen können wir nur unter Bedingungen hervorbringen, unter denen die gleichzeitige Entstehung von Tonempfindungen ausgeschlossen ist: so namentlich, wenn Schallwellen während zu kurzer Zeit auf das Ohr einwirken, als daß eine Tonempfindung entstehen könnte. Die auf solche Weise erzeugten einfachen Geräuschempfindungen können sich nach ihrer Intensität beträchtlich unterscheiden. Dagegen scheinen sie qualitativ relativ gleichförmig zu sein. Zwar ist es möglich, daß geringe Qualitätsunterschiede je nach den Entstehungsbedingungen des Geräusches existieren; doch sind sie jedenfalls zu klein, als daß sie durch Unterschiede der Bezeichnung fixiert werden könnten. Die gewöhnlich so genannten Geräusche sind Vorstellungsverbindungen, die aus jenen einfachen Geräuschempfindungen und aus sehr zahlreichen und unregelmäßigen Tonempfindungen zusammengesetzt sind. (Vgl. § 9, 7.) Das gleichförmige System der einfachen Geräusche ist nun wahrscheinlich entwicklungsgeschichtlich das ursprünglichere. Die einfachen, mit Otolithen versehenen Gehörbläschen der niederen Tiere können schwerlich andere als solche einfache Geräuschempfindungen erzeugen. Viele dieser Organe haben aber entweder gleichzeitig oder sogar ausschließlich die Bedeutung innerer Tastorgane, sogenannter tonischer Sinnesorgane, welche Empfindungen vermitteln, die mit den Stellungen und Bewegungen des Körpers veränderlich sind. Bei den höheren Wirbeltieren und dem Menschen scheiden sich dann diese Funktionen: der Vorhof mit den Bogengängen des Labyrinths funktioniert hier wahrscheinlich nur noch als tonisches Organ (vgl. § 10, 12), die Schnecke nur als Gehörorgan. Diese Verhältnisse weisen zugleich deutlich auf den genetischen Zusammenhang des Gehörs mit dem Tastsinne hin.
10. Das System der einfachen Tonempfindungen bildet eine stetige Mannigfaltigkeit von einer Dimension. Wir bezeichnen die Qualität der einzelnen einfachen Tonempfindung als Tonhöhe. Die eindimensionale Beschaffenheit dieses Systems findet darin ihren Ausdruck, daß wir von einer gegebenen Tonhöhe aus stets nur nach zwei einander entgegengesetzten Richtungen die Qualität ändern können: in der Richtung der Erhöhung und in der der Vertiefung des Tons. In der wirklichen Erfahrung ist uns eine einfache Tonempfindung niemals vollkommen rein für sich allein gegeben, sondern teils verbindet sie sich mit andern Tonempfindungen, teils auch mit begleitenden einfachen Geräuschempfindungen. Aber indem diese begleitenden Elemente nach dem früher (§ 5) gegebenen Schema beliebig wechseln können und in vielen Fällen im Vergleich mit einem einzelnen Ton verhältnismäßig schwach sind, ist schon die praktische Anwendung der Tonempfindung in der Kunst der Musik zur Abstraktion der einfachen Tonempfindungen gelangt. Mit den Symbolen c, cis, des, d usw. bezeichnen wir einfache Töne, obgleich die Klänge musikalischer Instrumente oder der menschlichen Singstimme, mittels deren wir diese Tonhöhen hervorbringen, immer noch von andern, schwächeren Tönen und häufig auch von Geräuschen begleitet sind. Da sich übrigens die Bedingungen der Entstehung solcher Begleittöne willkürlich derart variieren lassen, daß sie sehr schwach werden, so ist es auch der akustischen Technik gelungen, wirklich einfache Töne in nahezu vollendeter Reinheit herzustellen. Das einfachste Mittel dazu besteht darin, daß man Stimmgabeln in Verbindung mit Resonanzräumen bringt, die auf die Grundtöne der Stimmgabeln abgestimmt sind. Da der Resonanzraum nur den Grundton verstärkt, so sind beim Ausklingen der Stimmgabel die sonstigen begleitenden Töne so schwach, daß man die Empfindung in der Regel als eine einfache, unzerlegbare auffaßt. Untersucht man die einer solchen Tonempfindung entsprechenden Schallschwingungen, so entsprechen diese zugleich der einfachsten überhaupt möglichen Schwingungsbewegung, nämlich der pendelartigen Schwingung, so genannt, weil dabei die Oszillationen der Luftteilchen nach demselben Gesetz erfolgen, nach welchem die Schwingungen eines in sehr kleinen Amplituden sich bewegenden Pendels stattfinden1). Daß diese relativ einfachen Schallschwingungen einfachen Tonempfindungen entsprechen, und daß wir sogar aus Verbindungen solcher Empfindungen einzelne heraushören können, läßt sich auf Grund der Einrichtungen des Schneckenapparats aus den Gesetzen des Mitschwingens ableiten. Da nämlich die die Schnecke durchziehende Membran, in der die Endigungen des Hörnerven sich augbreiten, die "Grundmembran" (membrana basilaris), von unten nach oben stetig in ihrer Breite zunimmt, so kann man annehmen, daß sie in ihren verschiedenen Teilen auf verschiedene Tonhöhen abgestimmt sei. Nach dieser zuerst von Helmholtz aufgestellten "Resonanzhypothese" wird demnach, wenn eine einfache pendelartige Schallschwingung das Ohr trifft, nur der auf sie abgestimmte Teil mitschwingen; und wenn dieselbe Schwingungsgeschwindigkeit in irgendeiner zusammengesetzten Schallbewegung vorkommt, so wird jene nur den auf sie abgestimmten Teil, die übrigen Bestandteile der Schallbewegung werden aber andere, ihnen in gleicherweise entsprechende Abschnitte der Grundmembran mitschwingen lassen. (Vgl. § 9, 7a.)
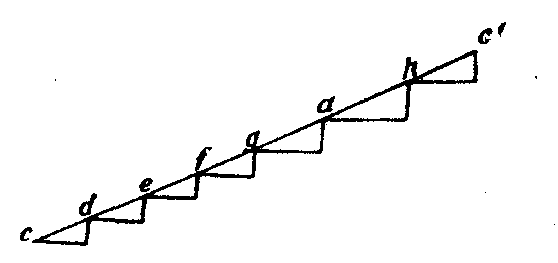
Fig. 3, Tonlinie und Tonskala (G-Dur-Skala).
Bei den verschiedenen Tonleitern unserer Musiksysteme fallen übrigens die Intervalle der Töne jedesmal wieder mit andern Punkten der stetigen Tonlinie der Empfindungen zusammen. Unsere Instrumente mit fester Stimmung der Einzeltöne, wie z. B. das Klavier, suchen daher durch die Einschaltung der fünf halben Töne in die Oktave zwar nicht ganz, aber annähernd den Wechsel zwischen den verschiedenen Tonleitern unseres Musiksystems (C-Dur, H-Moll, B-Dur usw.) zu ermöglichen (sogenannte Stimmung nach gleichschwebender Temperatur).
Die ganze Tonlinie hat schließlich zwei Endpunkte, die physiologisch durch die Grenzen der Reizbarkeit des Gehörapparats bedingt sind: den tiefsten und den höchsten Ton, von denen jener einer Schwingungsbewegung von 12–16, dieser einer solchen von 40000–50000 Doppelschwingungen in der Sekunde entspricht. Doch ist die letztere Grenze einigermaßen zweifelhaft, da ebensowohl die subjektive Erkennung der Intervalle wie die objektive Bestimmung der Schwingungszahlen tönender Körper (Stimmgabeln oder Pfeifen) in dieser Höhe unsicher wird. In den mittleren Lagen der Tonlinie (zwischen 200 und 1000 Schw.) können wir sukzessiv angegebene Töne schon bei einem Unterschied von etwa 1/5 Schw. in der Sek. nach ihrer Höhe unterscheiden, und dabei bleibt zugleich in diesem Falle der absolute Betrag dieses Unterschieds innerhalb der angegebenen Grenzen bei den verschiedenen Tonhöhen der gleiche. Damit stimmt überein, daß, wenn wir nach dem unmittelbaren Eindruck der Tonhöhen irgendeine Tonstrecke t h halbieren, also zu dem tieferen Ton t und dem höheren h denjenigen mittleren Ton m bestimmen, der gleichweit von beiden entfernt zu sein scheint, bei allen, auch bei ganz unharmonischen Intervallen, der Ton m nach seiner objektiven Schwingungszahl in der Mitte zwischen t und h liegt. Doch sind solche Vergleichungen, wie bei allen Empfindungen, nur möglich, solange die Distanzen nicht allzu groß sind; bei Tönen z. B. dürfen sie den Umfang einer Oktave nicht erheblich überschreiten. Bei tieferen und noch mehr bei höheren Tönen nimmt übrigens die Unterschiedsempfindlichkeit beträchtlich ab. Ebenso ist sie für die Intensität von Tönen und Geräuschen eine sehr unvollkommene. Sie ist aber hier auch insofern eine abweichende, als die Empfindlichkeit nicht für gleiche absolute, sondern für gleiche relative Unterschiede der Schallstärke konstant ist, indem jeweils die eben unterscheidbare Differenz zweier sukzessiv gehörter Schalleindrücke etwa = 1/10 der objektiven Schallstärke gefunden wird.
Literatur. Helmholtz,
Lehre von den Tonempfindungen, Abschn. I, IV und IX. Hensen, Physiol. des
Gehörs, in Hermanns Handbuch der Physiol., III, 2(1880). Stumpf, Tonpsychologie,
II (1890), §28 (Geräusch und Klang). Zeitschr. f. Psychologie,
Bd. 75. K. L. Schaefer, Art. Gehörssinn in Nagels Handbuch der Physiol.,
Bd. III. Phys. Psych.6, II. Kap. 10. M. u. T.5 Vorl.
5. – Preyer, Die Grenzen der Tonwahrnehmung, 1876. Luft, Unterscheidung
von Tonhöhen, Phil. Studien, Bd. 4. Schischmanow, U. von Intervallen,
ebenda, Bd. 5. Lorenz, Einteilung von Tonstrecken, ebenda, Bd. 6. Sander,
Ansteigen der Schallerregung, Psychol. Stud., Bd. 6. Klemm, Schallokalisation,
ebenda Bd. 8. Über Unterschiedsempfindlichkeit für Schallstärken
vgl. § 17, 10. Über Grenzen der
Tonempfindung und schwächste empfindbare Töne: Schwendt, Archiv
f. Ohrenheilkunde, Bd. 49. Zwaardemaker-Quitt, Arch. f. Physiol., 1902.
Suppl. M. Wien, Pflügers Archiv, Bd. 97. Weitere Literatur zur Tonwahrnehmung
siehe § 9.
C. Die Geruchs- und Geschmacksempfindungen.
12. Die Geruchsempfindungen bilden ein mannigfaltiges System von bisher noch unbekannter Anordnung. Wir wissen nur, daß es eine sehr große Anzahl verschiedener Geruchsqualitäten gibt, zwischen denen sich alle möglichen stetigen Übergänge vorfinden. Hiernach ist es zweifellos, daß das System eine mehrdimensionale Mannigfaltigkeit ist.
12a. Als ein Hinweis auf eine dereinst vielleicht mögliche Reduktion der Geruchsempfindungen auf eine kleinere Anzahl von Hauptqualitäten läßt sich die Tatsache betrachten, daß man die Gerüche in gewisse Klassen ordnen kann, deren jede solche Empfindungen enthält, die mehr oder weniger verwandt sind. Derartige Klassen sind z. B. die ätherischen, aromatischen, balsamischen, moschusartigen, brenzligen Gerüche usw. Einzelne Beobachtungen lehren, daß gewisse Qualitäten, die durch bestimmte Geruchsstoffe entstehen, auch durch Mischung anderer Geruchsstoffe erzeugt werden können. Aber diese Erfahrungen reichen bis jetzt nicht aus, um die große Menge von Einzelgerüchen, die jede der erwähnten Klassen enthält, auf eine begrenzte Anzahl von Hauptqualitäten und deren Mischungen zurückzuführen. Endlich hat man noch beobachtet, daß sich manche Geruchsreize, in den geeigneten Intensitätsverhältnissen angewandt, in der Empfindung kompensieren; und zwar geschieht dies nicht nur bei solchen Stoffen, die sich, wie z. B. Essigsäure und Ammoniak, chemisch neutralisieren, sondern auch bei solchen, die, wie z. B. Kautschuk und Wachs oder Tolubalsam, außerhalb der Riechzellen chemisch nicht aufeinander einwirken. Da jedoch diese Kompensation auch dann stattfindet, wenn die beiden Gerüche auf ganz verschiedene Riechflächen, der eine auf die rechte, der andere auf die linke Nasenschleimhaut einwirken, so handelt es sich hier wahrscheinlich nicht um eine dem unten (22) zu besprechenden Komplementarismus der Farben analoge Erscheinung, sondern möglicherweise um eine zentrale wechselseitige Hemmung der Empfindungen. Gegen jene Analogie spricht außerdem die Beobachtung, daß eine und dieselbe Geruchsqualität mehrere ganz verschiedene Qualitäten, ja zuweilen solche, die sich selbst wieder neutralisieren, kompensieren kann, während der Komplementa-rismus der Farben stets auf zwei einander fest zugeordnete Qualitäten beschränkt ist.
13. Etwas näher erforscht sind die Geschmacksempfindungen, insofern wir bei ihnen vier miteinander unvergleichbare Hauptqualitäten unterscheiden können, zwischen denen alle möglichen Übergänge, die wir als Mischempfindungen auffassen, vorkommen. Diese vier Hauptqualitäten sind: sauer, süß, bitter und salzig. Neben ihnen betrachtet man zuweilen noch laugenhaft (alkalisch) und metallisch als selbständige Qualitäten: unter diesen aber zeigt das Laugenhafte eine unverkennbare Verwandtschaft mit dem Salzigen, das Metallische mit dem Saueren; beide sind daher vielleicht Misch- oder Übergangsempfindungen (das Alkalische zwischen salzig und süß, das Metallische zwischen sauer und salzig). Von den genannten vier Hauptqualitäten stehen süß und salzig insofern in einem gegensätzlichen Verhältnis, als die eine dieser Empfindungen durch die andere, wenn diese die geeignete Stärke hat, zu einer neutralen (gewöhnlich "fade" genannten) Mischempfindung aufgehoben wird, auch ohne daß die Geschmacksreize, die sich in dieser Weise wechselseitig neutralisieren, eine chemische Verbindung miteinander eingehen. Hiernach ist das System der Geschmacksempfindungen wahrscheinlich als eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit aufzufassen, die geometrisch etwa durch ein Viereck dargestellt werden kann, dessen Ecken die vier Hauptqualitäten einnehmen, während die Seitenlinien und die übrige Fläche von den verschiedenen Mischempfindungen eingenommen werden.
13a. In diesen Eigenschaften der Geschmacksqualitäten scheint das Grundschema für das Verhalten eines chemischen Sinnes gegeben zu sein. In dieser Beziehung bildet der Geschmackssinn vielleicht eine Vorstufe zu dem Gesichtssinn. Der offenbare Zusammenhang mit der chemischen Natur des Reizungsvorganges macht es nämlich schon hier wahrscheinlich, daß die wechselseitige Neutralisation gewisser Empfindungen, mit der vielleicht die mehrdimensionale Beschaffenheit des Empfindungssystems zusammenhängt, nicht in den Empfindungen als solchen, sondern, ähnlich wie bei den Wärme- und Kälteempfindungen, in den Verhältnissen der physiologischen Reizung begründet ist. Den chemischen Wirkungen bestimmter Stoffe kommt bekanntlich sehr allgemein die Eigenschaft zu, daß sie durch die Wirkungen bestimmter anderer Stoffe neutralisiert werden können. Nun wissen wir nicht, welches die chemischen Veränderungen sind, die durch die Geschmacksreize in den Schmeckzellen hervorgebracht werden. Aber aus der Kompensation der Empfindungen süß und salzig können wir nach dem Prinzip des Parallelismus der Empfindungs- und Reizungsunterschiede schließen, daß sich auch die chemischen Reaktionen, welche die süßen und die salzigen Geschmacksstoffe in den Sinneszellen erzeugen, aufheben. Rücksichtlich der physiologischen Bedingungen der Geschmacksreizung läßt sich aus diesen Verhältnissen nur das eine schließen, daß die solchen sich neutralisierenden Empfindungen entsprechenden chemischen Reizungsvorgänge wahrscheinlich in den gleichen Sinneszellen stattfinden. Natürlich ist aber die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß in den nämlichen Gebilden mehrere durch entgegengesetzte Reaktionen neutralisierbare Vorgänge entstehen können. Die anatomischen Befunde und die physiologischen Versuche mit distinkter Reizung einzelner Geschmackspapillen geben hierüber keine sichere Entscheidung. Ob es sich bei den erwähnten Kompensationserscheinungen um einen eigentlichen, dem der Farben entsprechenden Komplementarismus (s. unten 22) handelt, ist übrigens auch hier noch zweifelhaft.
Literatur. Über Geruch: Zwaardemaker, Physiologie des Geruchs, 1895. Archiv f. Anat. u. Physiol., 1908. Henning, Zeitschr. f. Psychologie, Bd. 73–75. Geschmack: W. Nagel, Bibl. zool. 18, 1894, u. Pflügers Arch. f. Physiol., Bd. 54. Oehrwall, Skandin. Archiv f. Physiol., Bd. 2. Kiesow, Philos. Studien, Bd. 9, 10 u. 12. Haenig, ebenda, Bd. 17.
D. Die Lichtempfindungen.
14. Das System der Lichtempfindungen besteht aus zwei Partialsystemen, den farblosen Empfindungen und den Farbenempfindungen, zwischen deren Qualitäten aber alle möglichen stetigen Übergänge stattfinden können.
Die farblosen Empfindungen bilden, für sich allein betrachtet, ein System von einer Dimension, die sich, analog der Tonlinie, zwischen zwei Grenzpunkten erstreckt. Die dem einen dieser Grenzpunkte naheliegenden Empfindungen nennen wir Schwarz, die dem andern naheliegenden Weiß; zwischen beide schalten wir das Grau in seinen verschiedenen Nuancen (Dunkelgrau, Grau, Hellgrau) ein. Dieses eindimensionale System hat die Eigenschaft, daß es, abweichend von der Tonlinie, gleichzeitig ein Qualitäts- und ein Intensitätssystem ist, indem jede Qualitätsänderung in der Richtung von Schwarz nach Weiß zugleich als Intensitätszunahme, und jede Qualitätsänderung in der Richtung von Weiß nach Schwarz als Intensitätsabnahme empfunden wird. Jede auf solche Weise qualitativ und intensiv bestimmte Stufe des Systems nennt man die Helligkeit der farblosen Empfindung. Hiernach kann man auch das ganze System als das der reinen Helligkeitsempfindungen bezeichnen, wobei in diesem Falle der Zusatz "rein" die Abwesenheit farbiger Empfindungen andeutet. Das System der reinen Helligkeitsempfindungen ist demnach ein absolut eindimensionales in dem Sinne, daß bei ihm Qualitäts- und Intensitätsabstufungen in eine und dieselbe Dimension fallen, wesentlich verschieden von der Tonlinie, bei der jeder Punkt nur eine Qualitätsstufe bezeichnet, zu der dann noch in ebenfalls linearer Abstufung der Intensitätsgrad hinzukommt. Während also die einfachen Tonempfindungen, sobald man ihre qualitativen und intensiven Eigenschaften gleichzeitig in Betracht zieht, ein zweidimensionales Kontinuum bilden, bleibt das System der reinen Helligkeitsempfindungen unter Berücksichtigung beider Bestimmungsstücke eindimensional (Fig. 4). Das ganze System läßt sich daher auch als eine stetige Reihe von Helligkeitsgraden auffassen, wobei die niederen Grade ihrer Qualität nach als schwarz, ihrer Intensität nach als schwach, die höheren Grade ihrer Qualität nach als weiß, ihrer Intensität nach als stark bezeichnet werden. Unsere Empfindlichkeit für Helligkeitsunterschiede ist namentlich bei mittleren Graden sehr groß, indem sie 1/100 - 1/150 der vorhandenen Helligkeit beträgt, dabei aber wieder, wie für die Schallstärken (s. o.), in ihrem relativen Werte konstant ist (Webersches Gesetz, § 17, 10).
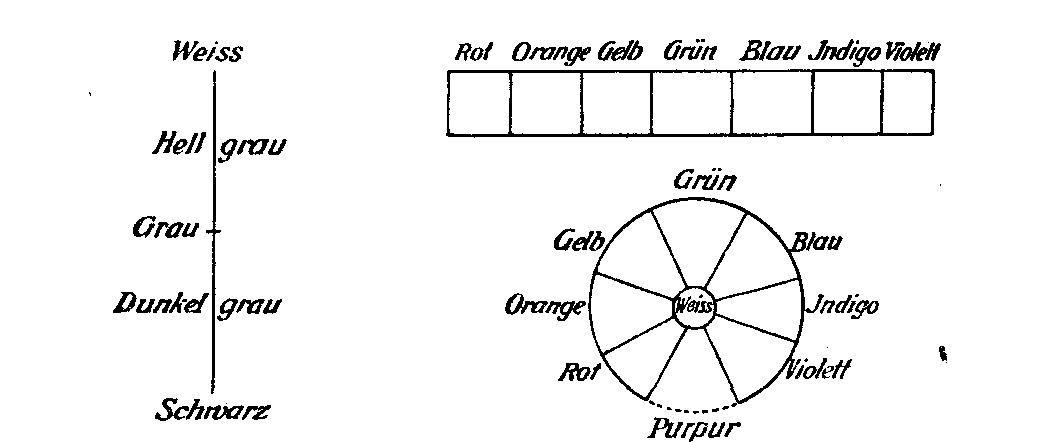
Fig. 4. System der Fig. 5. Farbenspektrum und reinen
Helligkeitsempfindungen. Farbenkreis.
15. Die Farbenempfindungen bilden, wenn man bloß
ihre Qualität berücksichtigt, ebenfalls ein eindimensionales
System. Dasselbe hat aber, im Unterschiede von den reinen Helligkeitsempfindungen,
die Eigenschaft, daß es, von welchem Punkte man auch ausgehen möge,
in sich zurückläuft, indem man zunächst allmählich
zu einer Qualität größter Differenz, dann von dieser aus
wieder zu ähnlicheren Qualitäten und schließlich zum Ausgangspunkte
zurückkommt. Das durch die Brechung des Sonnenlichts in einem Prisma
gewonnene oder das am Regenbogen gesehene Farbenspektrum zeigt bereits
diese Eigenschaft, wenngleich nicht vollständig. Geht man nämlich
von dem roten Ende dieses Spektrums (s. Fig. 5) aus, so gelangt man zunächst
zu Orange, dann zu Gelb, Gelbgrün, Grün, Grünblau, Blau,
Indigoblau bis zu Violett, welches letztere wieder dem Rot ähnlicher
ist als alle zwischenliegenden Farben mit Ausnahme der ihm nächsten,
des Orange. Wenn diese Linie der Farben des Spektrums nicht ganz in sich
zurückläuft, so hat dies aber darin seinen Grund, daß sie
überhaupt nicht alle in unserer Empfindung vorhandenen Farben enthält.
Es fehlen nämlich im Spektrum die purpur-roten Farbentöne, die
man physikalisch durch Mischung roter und violetter Strahlen erhalten kann.
Ergänzt man die Reihe der Spektralfarben durch diese, so wird das
System der wirklichen Farbenempfindungen erst vollständig; und dann
bildet es tatsächlich eine bis zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrende
Linie. Es läßt sich demnach am einfachsten durch eine Kreislinie,
den Farbenkreis, darstellen (Fig. 5).
Da man nun in diesem Kreise von jeder gegebenen Farbe durch allmähliche Änderungen der Empfindung zunächst zu den ihr ähnlichen, dann zu den von ihr verschiedensten und endlich wieder zu den in anderer Richtung ihr ähnlichen gelangen kann, so ist jeder Farbe eine bestimmte andere Farbe zugeordnet, die dem Maximum des Empfindungsunterschieds entspricht (§ 5 Fig. l E ' E"). Diese Farbe kann man als die Gegenfarbe bezeichnen; und bei der Darstellung des Farbensystems durch eine Kreislinie verlegt man je zwei einander zugeordnete Gegenfarben an die entgegengesetzten Endpunkte eines Kreisdurchmessers. So sind z. B. Purpurrot und Grün, Gelb und Blau, Gelbgrün und Violett usw. Gegenfarben, d. h. sie sind größte qualitative Empfindungsunterschiede. Die Empfindlichkeit für absolute wie relative Werte objektiver Unterschiede der Lichtschwingungen ist übrigens eine inkonstante, von einem Punkt zum andern der Farbenlinie stetig veränderliche. Sie ist im allgemeinen am größten im Gelb und im Blau, am kleinsten im Rot und Violett, hat aber auch zwischen Gelb und Blau, im Grün, ein drittes relatives Minimum. Irgendeine Regelmäßigkeit, wie für die Tonqualitäten oder auch für die reinen Helligkeitsgrade, ist also hier nicht nachzuweisen.
Die durch die Einordnung in den Farbenkreis bestimmte Qualität der Empfindung nennt man, zur Unterscheidung von andern qualitativen Bestimmungen, mit einem den Tonqualitäten entnommenen bildlichen Ausdruck den Farbenton. Neben ihm besitzt aber jede Farbenempfindung noch zwei Eigenschaften, von denen wir die eine den Farbengrad oder auch die Sättigung der Farbe, die andere die Helligkeit nennen. Von diesen ist der Farbengrad den Farbenempfindungen eigentümlich, während die Helligkeit ihnen mit den farblosen Lichtempfindungen gemeinsam zukommt.
16. Unter Farbengrad oder Sättigung versteht man die Eigenschaft der Farbenempfindungen, in beliebigen Übergängen zu farblosen Empfindungen vorzukommen, so zwar, daß von jeder Farbe zu jeder Stufe in der Reihe der farblosen Empfindungen, zu Weiß, Grau, Schwarz, stetige Übergänge möglich sind. Der Ausdruck "Sättigung" ist hierbei der gewöhnlichen objektiven Herstellungsweise dieser Übergänge, der Sättigung eines farblosen Lösungsmittels mit Farbstoffen entnommen. Da nun der Endpunkt in einer Reihe stetig abnehmender Sättigungen einer beliebigen Farbe stets eine farblose Empfindung ist, so läßt sich der Farbengrad als eine allen Farbenempfindungen zukommende Bestimmung betrachten, durch die zugleich das System der Farbenempfindungen mit dem der farblosen in Verbindung gebracht wird. Die sämtlichen Farbengrade, die als Übergänge von einer bestimmten Farbe zu einer bestimmten farblosen Empfindung, Weiß, Grau oder Schwarz, vorkommen, werden nämlich offenbar, wenn man die letztere durch einen Punkt repräsentiert denkt, der mit dem Mittelpunkt des Farbenkreises zusammenfällt, durch denjenigen Halbmesser des Kreises dargestellt werden können, der jenen Mittelpunkt mit der betreffenden Farbe verbindet. Denkt man sich die den stetigen Übergängen zu einer farblosen Empfindung entsprechenden Sättigungsgrade aller Farben auf diese Weise räumlich dargestellt, so nimmt daher das so gewonnene System der Farbengrade die Form einer Kreisfläche an, deren Peripherie dem System der einfachen Farbentöne, und deren Mittelpunkt einer farblosen Empfindung entspricht (Fig. 5). Hierbei kann man aber jeden beliebigen Punkt aus dem geradlinigen Kontinuum der farblosen Empfindungen wählen, um ein System von Farbengraden zu konstruieren, solange nur die Bedingung erfüllt ist, daß das Weiß nicht zu hell, oder das Schwarz nicht zu dunkel sei, weil sonst sowohl die Sättigungs- wie die Farbenunterschiede verschwinden. Sobald man nun dies für alle möglichen Punkte ausführt, so wird damit von selbst das System der Farbengrade durch das der Helligkeitsgrade ergänzt.
17. Die Helligkeit ist eine der Farbenempfindung ebenso notwendig wie der farblosen Empfindung zukommende Eigenschaft, die dort wie hier eine qualitative und eine intensive zugleich ist. Geht man nämlich von einer bestimmten Helligkeitsstufe aus, so nähert sich jede Farbe, wenn man ihre Helligkeit zunehmen läßt, in ihrer Qualität dem Weiß, während gleichzeitig die Intensität der Empfindung wächst; und wenn man ihre Helligkeit abnehmen läßt, so nähert sie sich in ihrer Qualität dem Schwarz, während gleichzeitig die Intensität der Empfindung sinkt. Die Helligkeitsgrade jeder einzelnen Farbe bilden also ein den farblosen oder reinen Helligkeitsempfindungen analoges System intensiver Qualitäten, nur daß an die Stelle der zwischen Weiß und Schwarz sich bewegenden farblosen Qualitätsabstufungen hier die entsprechenden Sättigungsgrade getreten sind, wobei aber von dem Punkte größter Sättigung aus zwei einander entgegengesetzte Richtungen abnehmender Sättigung existieren: die positive in der Richtung des Weiß, die intensiv mit Zunahme der Empfindung verbunden ist, und die negative in der Richtung des Schwarz, der eine Abnahme der Empfindung entspricht. Als Grenzpunkte beider Sättigungsabstufungen ergeben sich dort die reine Empfindung Weiß und hier die reine Empfindung Schwarz, von denen jene zugleich ein Maximum, diese ein Minimum der Empfindungsintensität darstellt. Daraus folgt, daß es eine gewisse mittlere Helligkeit für eine jede Farbe gibt, bei der ihre Sättigung am größten ist, und von der aus diese bei Zunahme der Helligkeit in positiver Richtung (nach Weiß), bei Abnahme der Helligkeit in negativer Richtung (nach Schwarz) abnimmt. Dieser für die Sättigung günstigste Helligkeitswert ist nicht für alle Farbenempfindungen der nämliche, sondern er stuft sich von Rot nach Blau derart ab, daß er für Rot am höchsten, für Blau am niedrigsten liegt. Daraus erklärt sich die Erscheinung, daß in der Dämmerung, also bei schwacher Helligkeit, die blauen Farbentöne z. B. an Gemälden noch deutlich empfunden werden, während die roten schon schwarz aussehen. (Purkinjesches Phänomen.)
18. Sieht man von dieser etwas verschiedenen Lage der Punkte maximaler Sättigung in der Linie der Helligkeitsgrade jeder einzelnen Farbe ab, so läßt sich nun der Beziehung, in welche durch den allmählichen Übergang in Weiß einerseits und in Schwarz anderseits das System der farbigen Helligkeitsempfindungen zu dem der reinen oder farblosen Helligkeitsempfindungen tritt, offenbar am einfachsten in folgender Weise Ausdruck geben. Denkt man sich das System der reinen Farbentöne oder der Farben im Maximum ihrer Sättigung wie oben (Fig. 5) als Kreislinie, und denkt man sich in dem Mittelpunkt der zu dieser Linie gehörigen Kreisfläche die Linie der reinen Helligkeitsempfindungen (Fig. 4) als senkrechte Grade derart aufgetragen, daß in den Mittelpunkt des Kreises die zu ihm gehörige farblose Empfindung fällt, so werden sich in analoger Weise die Farbensysteme zunehmender und abnehmender Helligkeit oben und unten von jenem Kreise größter Farbensättigung in der Form von Kreisen auftragen lassen. Dabei ist dann aber hier wie dort die allmähliche Abnahme der Sättigung durch den immer mehr abnehmenden Halbmesser der kontinuierlich aneinander gefügten Farbenkreise auszudrücken, bis endlich an den beiden Endpunkten der Linie der reinen Helligkeitsempfindungen die Kreise ganz verschwinden, entsprechend dem Satze, daß für jede Farbe das Maximum der Helligkeit der Empfindung Weiß, und ihr Minimum der Empfindung Schwarz entspricht2). Das gesamte System der Farben- und Helligkeitsempfindungen läßt sich daher durch ein in sich geschlossenes körperliches Gebilde von der Form eines Doppelkegels darstellen, dessen beide Hälften sich mit ihrer Basis berühren (Fig. 6), oder auch in der Form einer Kugel, deren einer Pol dem dunkelsten Schwarz, und deren anderer dem hellsten Weiß entspricht. In dieser geometrischen Versinnlichung ist die Tatsache ausgedrückt, daß das System der Lichtempfindungen ein dreidimensionales und in sich geschlossenes Kontinuum darstellt. Die dreidimensionale Beschaffenheit entspringt hier aus der Zusammensetzung einer jeden konkreten Lichtempfindung aus drei Bestimmungsstücken, Farbenton, Sättigung und Helligkeit, wobei man die reine oder farblose Helligkeitsempfindung und die Farbenempfindung vom Maximum der Sättigung als die beiden Grenzfälle in der Abstufung der Farbengrade zu betrachten hat. Die in sich geschlossene Form ergibt sich aus der in sich geschlossenen Beschaffenheit der Farbenempfindungen und aus der Begrenzung des Systems der farblosen Helligkeiten durch die Endpunkte der reinen Helligkeitsempfindungen. Eine besondere Eigentümlichkeit des Systems ist es endlich, daß nur die Veränderungen in den zwei Dimensionen der Farbentöne und ihrer Sättigungsgrade reine Qualitätsänderungen sind, daß dagegen jede Verschiebung in der dritten Dimension, in der der Helligkeitsempfindungen, gleichzeitig eine qualitative und eine intensive Veränderung ist. Infolge dieses Umstandes ist zwar das ganze dreidimensionale System erforderlich, um die Qualitäten der Lichtempfindung erschöpfend darzustellen, dieses System umfaßt nun aber zugleich die Intensitäten der Empfindung.
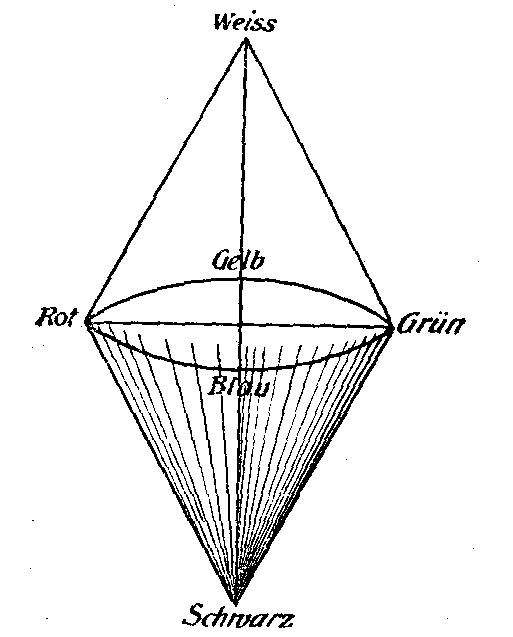
Fig. 6. Farbenkegel.
19. In dem System der Lichtempfindungen nehmen gewisse Hauptempfindungen eine bevorzugte Stelle ein, weil wir sie als Orientierungspunkte zur Einordnung aller übrigen benutzen. Solche Hauptempfindungen sind in der farblosen Reihe Weiß und Schwarz, unter den Farbenempfindungen die vier, zuerst von Leonardo da Vinci hervorgehobenen Hauptfarben Rot, Gelb, Grün und Blau. Nur für diese sechs Empfindungen hat die Sprache verhältnismäßig frühe schon scharf geschiedene Bezeichnungen geschaffen. Alle andern wurden dann teils mit Rücksicht auf sie, teils sogar unter Benutzung der für sie gebrauchten Wörter gebildet. So fassen wir Grau als eine in der farblosen Reihe zwischen Weiß und Schwarz liegende Zwischenstufe auf. Die verschiedenen Sättigungsgrade bezeichnen wir je nach ihrem Helligkeitswert als weißliche oder schwärzliche, helle oder dunkle Farbentöne, und für die zwischen den Hauptfarben gelegenen Farben wählen wir meist Übergangsbezeichnungen, wie purpurrot, orangegelb, gelbgrün usw., Namen, die in ihrer Bildungsweise schon ihre relativ späte Entstehung verraten.
19a. Aus dieser größeren Ursprünglichkeit der sprachlichen Bezeichnungen für die genannten sechs Empfindungsqualitäten hat man geschlossen, sie seien in dem Sinne Grundqualitäten des Gesichtssinns, daß jede andere aus ihnen oder aus einzelnen von ihnen zusammengesetzt sei. Grau erklärte man also für eine Mischempfindung aus Schwarz und Weiß, Violett und Purpurrot für eine solche aus Blau und Rot usw. Nun ist es aber psychologisch nicht zutreffend, daß irgendwelche dieser Lichtempfindungen im Vergleich mit andern als zusammengesetzt bezeichnet werden könnten. Grau ist ebensogut eine einfache Empfindung wie Weiß oder Schwarz; Orange, Purpurrot u. dgl. sind gerade so gut einfache Empfindungen wie Rot, Gelb usw., und irgendeine Sättigungsstufe, die wir in dem System zwischen eine reine Farbe und Weiß einordnen, ist deshalb keineswegs eine zusammengesetzte Empfindung. Wohl aber bringt es die in sich geschlossene und stetig zusammenhängende Beschaffenheit des Empfindungssystems mit sich, daß die Sprache, der es unmöglich ist, eine unbegrenzte Zahl von Bezeichnungen zu schaffen, gewisse besonders ausgeprägte Unterschiede herausgreift, nach denen dann alle andern Empfindungen geordnet werden. Daß für die farblose Reihe Schwarz und Weiß als solche Orientierungspunkte gewählt wurden, ist selbstverständlich, da sie die größten Unterschiede bezeichnen; sind sie aber einmal gegeben, so müssen wegen der stetigen Vermittelung dieser Unterschiede durch alle möglichen Helligkeitsstufen alle andern farblosen Empfindungen als Übergänge zwischen ihnen aufgefaßt werden. Ähnlich verhält es sich mit den Farbenempfindungen, nur daß hier wegen der in sich zurücklaufenden Beschaffenheit der Farbenlinie nicht unmittelbar zwei absolut größte Unterschiede gewählt werden konnten, sondern neben der zureichenden qualitativen Verschiedenheit noch andere Motive für die Wahl der Hauptfarben entscheidend wurden. Als solche wird man die in den natürlichen Existenzbedingungen des Menschen begründete Häufigkeit und die Gefühlsstärke bestimmter Lichteindrücke betrachten dürfen. Das Rot des Blutes, das Grün der Vegetation, das Blau des Himmels, das Gelb der im Kontrast zum blauen Himmel gelb erscheinenden Gestirne mögen wohl die frühesten Anlässe zur Wahl bestimmter Farbenbezeichnungen gewesen sein. Denn die Sprache benennt allgemein nicht die Objekte nach den Empfindungen, sondern umgekehrt die Empfindungen nach den Objekten, durch die sie erzeugt werden. Waren aber einmal auf diese Weise gewisse Hauptfarben festgelegt, so mußten wieder vermöge der Kontinuität der Empfindungen alle andern als zwischen ihnen liegende Farbentöne erscheinen. Der Unterschied der Haupt- und der Übergangsfarben ist also höchstwahrscheinlich nur in äußeren Bedingungen begründet; wären diese Bedingungen andere gewesen, so würde z. B. ebensogut Rot als Übergang zwischen Purpur und Orange aufgefaßt werden können, wie wir jetzt Orange als Übergangsfarbe zwischen Rot und Gelb ordnen3).
Literatur. Parkinje, Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne, 2, 1819–1823. Helmholtz, Physiol. Optik, § 19–21. Hering, Zur Lehre vom Lichtsinn, 5 u. 6, 1874–1878. (Vertritt die Ansicht vom subjektiven Ursprung der Farbenbenennungen und zieht aus ihr Folgerungen für die Theorie der Lichtempfindungen.) Wundt, Die Empfindung des Lichts und der Farben, Philos. Studien, Bd. 4. Phys. Ps.6, II, Kap. 10, 4. M. u. T.5, Vorl. 6. Unterschiedsempfindlichkeit für Farben: A. König und Dieterici, Archiv f. Ophthalm., Bd. 30, 2. König, Ztschr. f. Psychol. und Phys. d. Sinnesorg., Bd. 3.
Wie die farblose, so ist aber auch jede einzelne Farbenempfindung, wenngleich in einem beschränkteren Grade, mehrdeutig. Sobald man nämlich zwei objektive Farben mischt, die einander im Farbenkreis näher liegen als die Gegenfarben, so erscheint die Mischung nicht weiß, sondern farbig, und zwar in der Farbe, die auch in der Reihe der objektiv einfachen Farben der zwischenliegenden Empfindung entspricht. Hierbei ist nun allerdings, wenn die gemischten Farben den Ergänzungsfarben nahe kommen, die Sättigung der Resultanten stark vermindert; wenn sie dagegen einander sehr nahe rücken, so ist diese Verminderung nicht mehr wahrzunehmen: die Mischfarbe und die einfache Farbe werden daher in diesem Fall subjektiv meist gleich empfunden. So können wir z. B. das Orange des Spektrums von einer Mischung roter und gelber Strahlen absolut nicht unterscheiden. Da man auf diese Weise alle im Farbenkreis zwischen Rot und Grün gelegenen Farben durch Mischung von Rot und Grün, alle zwischen Grün und Violett gelegenen durch Mischung von Grün und Violett und endlich auch diejenige Farbe, die im Sonnenspektrum nicht enthalten ist, das Purpur, durch Mischung von Rot und Violett erhalten kann, so läßt sich demnach die ganze Reihe der in der Empfindung möglichen Farbentöne aus den drei objektiven Farben Rot, Grün, und Violett gewinnen. Mittels der nämlichen drei Farben läßt sich aber auch Weiß mit seinen Übergängen herstellen. Denn die Mischung von Rot und Violett gibt Purpur, Purpur ist die Komplementärfarbe von Grün, und das durch die Mischung von Purpur (Rot-Violett) und Grün hergestellte Weiß ergibt, den einzelnen Farben zugemischt, die verschiedenen Sättigungsgrade derselben.
22. Die drei auf solche Weise zur Erzeugung des ganzen Systems der Lichtempfindungen ausreichenden objektiven Farben bezeichnet man als die Grundfarben. Um ihre Bedeutung in dem System der Sättigungsgrade zum Ausdruck zu bringen, wählt man für die Darstellung desselben statt der bloß auf die psychologischen Verhältnisse zurückgehenden Kreisfläche eine Dreiecksfläche, wobei die ausgezeichnete Bedeutung der Grundfarben dadurch angedeutet wird, daß sie die drei Ecken des Dreiecks einnehmen, auf dessen Seiten dann die Farbentöne im Maximum der Sättigung auf getragen werden, während die übrigen Sättigungsgrade in ihren Übergängen zu dem in der Mitte gelegenen Weiß auf der Dreiecksfläche liegen (Fig. 7). Übrigens würde man an und für sich jede beliebige Dreiheit von Farben, falls sich diese in angemessenen Entfernungen befänden, zu Grundfarben wählen können. Die genannten, Rot, Grün und Violett, verdienen nur deshalb praktisch den Vorzug, weil sich am Anfang und am Ende des Spektrums die Empfindung am langsamsten mit der Schwingungsdauer ändert, so daß, wenn die Endfarben des Spektrums unter die Grundfarben aufgenommen werden, die durch Mischung zweier nahestehender Farben gewonnene Resultante der zwischen ihnen liegenden objektiv einfachen Farbe in der Empfindung am nächsten kommt5).
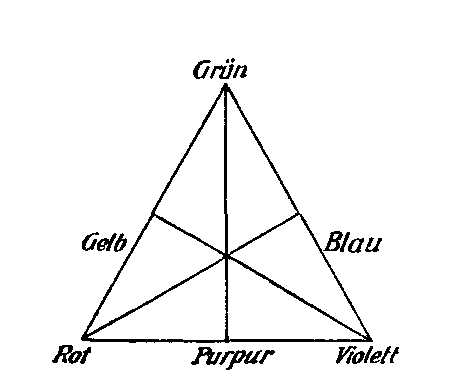
Fig. 7. Farbendreieck
24. Aus der Annahme, daß die Lichtreizung auf chemischen Vorgängen in der Netzhaut beruhe, läßt sich nun auch das relativ langsame Ansteigen der Empfindung und ihre relativ lange Nachdauer nach vorausgegangener Reizung erklären. Die Zeit, während deren ein Lichtreiz einwirken muß, um das Maximum der bei ihm möglichen Empfindungen auszulösen, beträgt für farbloses Licht durchschnittlich 0,1, für farbiges ohne Unterschied der Wellenlänge 0,3 Sekunden. Zugleich nehmen diese Zeiten etwas ab mit der Lichtstärke. Die erheblich größere Geschwindigkeit des Ansteigens der farblosen Erregung gegenüber der für alle Teile des Spektrums übereinstimmenden der farbigen weist aber offenbar ebenso auf eine spezifische Verschiedenheit der farblosen von den farbigen Erregungen wie auf einen inneren Zusammenhang der letzteren hin. Zu ähnlichen Ergebnissen führt die Untersuchung der Nachdauer der Erregung die man, indem man sie auf das als Reiz benützte Objekt bezieht, das Nachbild des Eindrucks zu nennen pflegt. Zunächst erscheint dieses Nachbild in einer dem Reize gleichen Helligkeits- oder Farbenbeschaffenheit: also weiß bei weißen, schwarz bei schwarzen und gleichfarbig bei farbigen Objekten (positives und gleichfarbiges Nachbild); nach kurzer Zeit geht es dann aber bei farblosen Eindrücken in die entgegengesetzte Helligkeit, weiß in schwarz, und schwarz in weiß, bei Farben in die Gegen- oder Komplementärfarbe über (negatives und komplementäres Nachbild). Bei der Einwirkung kurz dauernder Lichtreize im Dunkeln kann sich dieser Übergang mehrmals wiederholen, indem dem negativen abermals ein positives Nachbild folgt usw., so daß ein Oszillieren der Empfindung zwischen beiden Nachbildphasen stattfindet. Das positive Nachbild läßt sich wohl darauf zurückführen, daß die durch irgendeine Lichtart bewirkte photochemische Zersetzung nach der Einwirkung des Lichtes noch eine kurze Zeit. andauert; das negative und komplementäre kann man dagegen daraus ableiten, daß jede in einer bestimmten Richtung eingetretene Zersetzung eine teilweise Konsumtion der zunächst an ihr beteiligten lichtempfindlichen Stoffe zurückläßt, wodurch sich bei der Fortdauer der Netzhautreizung die photochemischen Vorgänge in entsprechendem Sinne verändern müssen. Diese Auffassung wird dadurch bestätigt, daß sich die Netzhaut in einem gegebenen Stadium des Abklingens eines Nachbildes irgendeinem plötzlich einwirkenden andern Lichtreize gegenüber genau so verhält, wie die unermüdete Netzhaut dem um den Betrag der Nachbildhelligkeit oder Nachbildfarbe veränderten Reize gegenüber (Fechner-Helmholtzsches Gesetz der negativen und komplementären Nachbilder). Dabei ist aber auch dieser Verlauf des Abklingens wieder ein abweichender bei farblosen und bei farbigen Nachbildern, während er sich bei den letzteren als ein wesentlich übereinstimmender erweist.
25. Mit den positiven und negativen Nachbildern hängen schließlich noch die Erscheinungen der Licht- und Farbeninduktion nahe zusammen. Sie bestehen darin, daß in der Umgebung irgendwelcher Lichteindrücke gleichzeitig Erregungen von gleicher oder entgegengesetzter Beschaffenheit entstehen. Die erste dieser Erscheinungen, die positive Lichtinduktion, ist die seltenere. Sie wird vornehmlich dann beobachtet, wenn ein Teil der Netzhaut erregt und ein angrenzender stark verdunkelt ist: es scheint dann die Licht- oder Farbenerregung auf diesen verdunkelten Teil auszustrahlen. In allen andern Fällen tritt die entgegengesetzte oder negative Induktionswirkung auf. Infolge derselben erscheint eine weiße Fläche von einem dunkeln, eine schwarze von einem hellen, eine farbige von einem komplementärfarbigen Rande umgeben. Diese Erscheinungen sind übrigens von psychologischen Kontrastvorgängen begleitet, die dem später (§ 17, 11) zu erörternden allgemeinen Prinzip der Hebung der Gegensätze entsprechen; und in der Regel ist es die Gesamtwirkung solcher physiologischer und psychologischer Einflüsse, die man als "Kontrast" bezeichnet. Dies wird zwar durch die Untrennbarkeit beider Faktoren einigermaßen gerechtfertigt. Doch würde es wohl zweckmäßiger sein, den physiologischen Faktor die induzierte Erregung zu nennen, und die Bezeichnung Kontrast jenem psychologischen Faktor vorzubehalten, welcher der auch auf andern Gebieten, insbesondere bei den räumlichen und zeitlichen Vorstellungen und bei den Gefühlen, nachzuweisenden Hebung der Gegensätze entspricht. Die Licht- und Farbeninduktion in diesem rein physiologischen Sinne besteht wahrscheinlich in einer Art negativer Irradiation der Reizung, wobei sich diese nicht, wie bei der positiven Induktion, unmittelbar in ihrer eigenen Qualität auf die Umgebung fortpflanzt, sondern hier eine Erregung von entgegengesetzter Beschaffenheit auslöst. Diese beruht möglicherweise darauf, daß die bei der Reizung einer Netzhautstelle verbrauchten photochemischen Stoffe zum Teil durch Zufluß aus ihrer Umgebung ersetzt werden, wodurch dann ein Lichteindruck auf diese Umgebung ähnlich wirken muß, wie bei den Nachbildern der Eindruck auf die zuvor gereizte Stelle selbst. Für diesen Zusammenhang mit den Nachbilderscheinungen spricht auch die Tatsache, daß, wie bei diesen, die Wirkung mit der Intensität der Lichteindrücke zunimmt. Hierdurch unterscheidet sich aber die physio-logische Lichtinduktion wesentlich von jenen psychologischen Kontrasterscheinungen, mit denen sie gewöhnlich zusammengeworfen wird, und auf die wir bei der allgemeinen Erörterung der Kontrastvorgänge (§ 17) zurückkommen werden.
25a. Nehmen wir das Prinzip des Parallelismus zwischen der Empfindung und dem physiologischen Reizungsvorgang zur Grundlage unserer Annahmen über die in der Netzhaut stattfindenden Prozesse, so ist zunächst zu folgern, daß der relativen Selbständigkeit, welche die farblosen in ihrem Verhältnis zu den farbigen Empfindungen behaupten, auch eine analoge Selbständigkeit der photochemischen Prozesse entsprechen werde. Vor allem zwei Tatsachen, von denen die eine dem subjektiven System der Lichtempfindungen, die andere den Erscheinungen der objektiven Farbenmischung angehört, lassen sich hieraus ungezwungen erklären. Die erste besteht darin, daß sich jede Farbenempfindung bei stark zu- oder abnehmender Helligkeit einer farblosen Empfindung nähert (Fig. 6), was am einfachsten zu deuten ist, wenn man annimmt, daß jede Farbenerregung physiologisch aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt sei, von denen der eine der farbigen und der andere der farblosen Erregung entspreche. Damit muß dann noch die weitere Bedingung verbunden sein, daß bei einer gewissen mittleren Reizstärke die farbige Erregungskomponente relativ am stärksten ist, während bei größeren und kleineren Reizwerten die farblose mehr und mehr überwiegt. Die zweite Tatsache besteht in der Existenz der Komplementärfarben. Diese begreift sich am leichtesten, wenn man annimmt, daß die Komplementärfarben, wie sie subjektiv größtmögliche Unterschiede der Empfindung sind (Fig. 5), so objektiv photochemische Prozesse bedeuten, die sich neutralisieren. Daß infolge dieser Neutralisation die farblose Erregung entsteht, wird aber wieder am einfachsten unter der Voraussetzung verständlich, daß sie von Anfang an jede farbige Erregung begleitet und daher allein zurückbleibt, sobald entgegengesetzte farbige Erregungen einander aufheben. Die Annahme einer relativen Unabhängigkeit der beiden photochemischen Prozesse der farblosen und der farbigen Empfindung wird durch das Vorkommen einer zuweilen angeborenen, zuweilen auch durch pathologische Prozesse der Netzhaut erworbenen Abnormität des Gesichtssinns, der totalen Farbenblindheit, bestätigt. Da bei ihr entweder auf der ganzen Netzhaut oder auf einzelnen Stellen derselben jede beliebige Lichtreizung als reine, farblose Helligkeit empfunden wird, so liegt darin der Beweis, daß farbige und farblose Erregung voneinander trennbare physiologische Prozesse sind.
Wenden wir die gleichen Gesichtspunkte auf den zweiten in der Netzhaut stattfindenden Vorgang, auf den der farbigen Erregung, an, so sind hier zunächst ebenfalls zwei Tatsachen maßgebend. Die eine besteht darin, daß zwei um eine endliche kleine Strecke voneinander entfernte Farben eine Mischfarbe ergeben, die der zwischen ihnen liegenden einfachen Farbe gleicht. Dies weist darauf hin, daß die Farbenerregung ein Vorgang ist, der sich nicht stetig, wie etwa die Tonerregung, sondern der sich in kleinen Stufen mit dem physikalischen Reize verändert, und zwar dergestalt, daß diese Veränderung z. B. im Rot und Violett in größeren Stufen vor sich geht als im Grün, wo sich schon bei der Mischung ziemlich nahe gelegener Farben Komplementärwirkungen geltend machen. Die zweite Tatsache besteht darin, daß bestimmte, einem gewissen größeren Reizunterschied entsprechende Farben, die Komplementärfarben, offenbar auf Prozessen beruhen, die sich neutralisieren. Chemische Prozesse können sich aber nur aufheben, wenn sie irgendwie von gegensätzlicher Natur sind. Nun existiert ein solcher Gegensatz für jede überhaupt in der Empfindung unterscheidbare Farbe, so daß zu jeder Stufe photochemischer Farbenerregung eine bestimmte Stufe von komplementärer Wirkung vorhanden ist. Der ganze Vorgang der Farbenerregung, wie er bei stetiger Veränderung der Wellenlänge des objektiven Lichtes, vom äußersten Rot beginnend und schließlich nach Überschreitung des Violett durch Hinzunahme der Purpurmischungen am Ausgangspunkt endigend, sich abspielt, wird so als eine unbestimmt große Reihenfolge photochemischer Zersetzungen aufzufassen sein, die zusammen einen in sich geschlossenen Kreisprozeß bilden, in welchem es zu jeder Stufe eine sie neutralisierende Gegenstufe, und zu dieser zwei nach entgegengesetzten Richtungen gehende Übergänge gibt.
Über die Anzahl der im ganzen in diesem Kreisprozeß vorhandenen photochemischen Stufen wissen wir nichts. Die mehrfach unternommenen Versuche, alle Farbenempfindungen auf eine möglichst kleine Anzahl solcher Stufen zurückzuführen, entbehren der zureichenden Begründung. Entweder werden bei ihnen ohne weiteres die Ergebnisse der physikalischen Farbenmischung in physiologische Prozesse umgedeutet: so bei der Annahme von drei Grundempfindungen, Rot, Grün und Violett, aus deren wechselnden Mischungen alle Lichtempfindungen, auch die farblosen, hervorgehen sollen (Young-Helmholtzsche Hypothese). Oder man geht von der psychologisch unhaltbaren Annahme aus, die Farbenbenennungen seien nicht aus dem Einfluß bestimmter äußerer Objekte, sondern aus der realen Bedeutung der entsprechenden Empfindungen hervorgegangen (s. o.), und nimmt demnach an, vier Grundfarben, nämlich die beiden Gegensatzpaare Rot und Grün, Gelb und Blau, seien die Substrate der Farbenempfindungen, denen man dann als ein ähnliches Gegensatzpaar für die reinen Helligkeitsempfindungen Schwarz und Weiß gegenüberstellt, während alle anderen Lichtempfindungen, wie Grau, Orange, Violett u. dgl., ihrer subjektiven wie objektiven Bedeutung nach Mischempfindungen sein sollen (Heringsche Hypothese). Zur Unterstützung der ersten wie der zweiten dieser Hypothesen hat man sich meist auf die nicht selten vorkommenden Fälle partieller Farbenblindheit berufen. Die Anhänger der drei Grundfarben behaupten, alle diese Fälle seien auf den gänzlichen Mangel der roten, der grünen oder der violetten Grundempfindung, oder zuweilen auch auf den bloß teilweisen Mangel derselben zurückzuführen. Die Anhänger der vier Grundfarben nehmen an, die partielle Farbenblindheit beziehe sich stets auf je zwei als Gegensätze zusammengehörige Grundfarben, sei also entweder Rotgrünblindheit oder Gelbblaublindheit. Eine unbefangene Prüfung der Farbenblinden bestätigt keine dieser Behauptungen. Ist die Dreifarbentheorie nicht imstande, die totale Farbenblindheit zu erklären, so widersprechen der Vierfarbentheorie die Fälle reiner Rot- und reiner Grünblindheit; und beiden Hypothesen widerstreiten schließlich die unzweifelhaft vorkommenden Fälle, in denen vorzugsweise solche Teile des Spektrums, die keiner der drei oder vier angenommenen Grundfarben entsprechen, farblos gesehen werden. Das einzige, was sich nach dem Stand unserer heutigen Kenntnisse aussagen läßt, ist also, daß jede einfache Lichtempfindung wahrscheinlich auf der Verbindung zweier photochemischer Prozesse beruht: eines achromatischen, der sich wieder aus einer bei größerer Lichtstärke überwiegenden Zersetzung und aus einer bei schwächerem Lichte vorwaltenden Restitution zusammensetzt, und eines chromatischen, welcher sich derart stufenweise verändert, daß die ganze Folge der photochemischen Farbenzersetzungen einen Kreisprozeß bildet, in dem sich die Zersetzungsprodukte je zweier relativ entferntester Stufen wechselseitig neutralisieren6).
Literatur. Helmholtz, Handbuch der physiolog. Optik, § 20–25. Hering, Zur Lehre vom Lichtsinn, l.–6. Abh. von Kries, Die Gesichtsempfindungen und ihre Analyse, 1882. Phys. Psych.6, I, Kap. 8, II Kap. 10. M. u. T.5 6. u. 7. Vorl. – Ansteigen der Erregung: Büchner, Berliner, Psych. Stud., Bd. 2 u. 3. Nachbilder: Fechner, Poggendorffs Ann. der Physik, Bd. 44 u. 50. Hering, Pflügers Archiv, Bd. 43. Charpentier, Compt. rend. 1881, t. 113. Wirth, Philos. Stud., Bd. 16–18. Goldschmidt, Psychol. Stud., Bd. 6. W. Lehmann, Pflügers Archiv, Bd. 143. Lichtinduktion (Kontrast): Brücke, Denkschr. der Wiener Akad. Math.-naturw. Kl., Bd. 3. Fechner, Poggendorffs Ann., Bd. 50. Hering, Pflügers Archiv, Bd. 41. Kirschmann, Philos. Stud., Bd. 6. Köhler, Arch. für die ges. Psychol., Bd. 2. Lichtempfindung bei Dunkeladaptation: Blachowski, Zeitschr. f. Sinnesphysiologie, 1914; Farbenblindheit: Holmgren, Die Farbenblindheit, 1878. König u. Dieterici, Zeitschr. für Psych., Bd. 4. Brodhun, ebenda, Bd. 3 u. 5. König, ebenda, Bd. 20. von Kries, ebenda, Bd. 13 u. 19. Köllner, Arch. f. Augenhk. Bd. 76. Kirschmann, Philos. Stud., Bd. 8. Lichtempfindung im indirekten Sehen und Purkinjesches Phänomen: Schön, Die Lehre vom Gesichtsfeld, 1874. A. E. Fick, Pflügers Archiv, Bd. 43. Kirschmann, Philos. Stud., Bd. 8. Hellpach, ebenda, Bd. 15. Peters, Arch. f. ges. Psychol., Bd. 3. von Kries, Ztschr. f. Psychol., Bd. 9 u. 16. Sherman, Phil. Stud., Bd. 13. Tschermak. Pflügers Archiv f. Physiol., Bd. 82. K. L. Schäfer, ebend. Bd. 160. Farbenschwelle bei Kindern: L. W. Jones, Pädagogisch-psychol. Arbeiten, herausgeg. von Brahn, l.